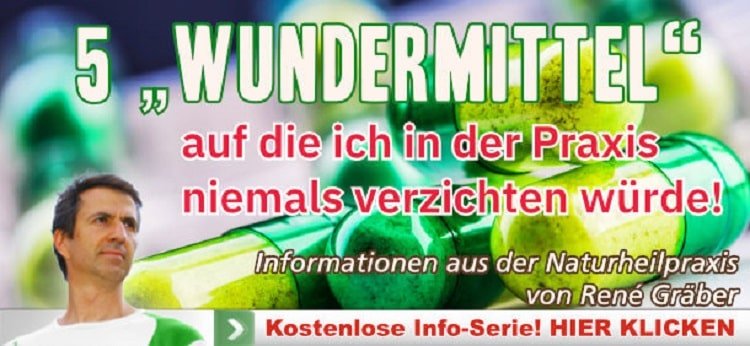Nein, dies ist KEIN Beitrag speziell zu Corona. Dies ist ein Beitrag, wie ich Grippe und grippale Infekte seit Jahrzehnten behandle. Grippe und Erkältungskrankheiten sind Viruserkrankungen, von denen einige Menschen ständig, andere selten bis nie betroffen sind. Und das gilt mit Sicherheit auch für die COVID-19 Grippe im Jahr 2020. Auch der individuelle Umgang des Körpers mit der Grippe ist sehr unterschiedlich: Manche kämpfen wochenlang mit schweren Symptomen, andere genesen quasi über Nacht, indem sie die Krankheit praktisch im Schlaf „ausschwitzen“…
„Ich habe die Grippe“
Haben Sie diesen Satz auch schon oft von Kollegen, Verwandten und Bekannten gehört?
Umgangssprachlich verstehen sich unter dem Synonym „Grippe“ mittlerweile diverse Erkältungskrankheiten in der medizinischen Laienwelt.
Grippe ist jedoch mit schweren Verlaufsformen gekennzeichnet und kann nicht mit einer harmlosen Erkältungskrankheit verglichen werden. Eigentlich heißt die Grippe auch gar nicht so, denn der medizinische Fachbegriff lautet „Influenza„.
Die Namensgebung stammt aus dem Mittelalter, wo die Menschen glaubten, dass Krankheiten mit Planetenkonstellationen zusammen hingen. Influenza stammt aus dem Italienischen und bedeutet „Einfluss“. Etwa seit dem 15. Jahrhundert wird der Name „Influenza“ ausschließlich für die Benennung der „Grippe“ genutzt.
Als Erreger der Influenza gelten sog. Orthomyxoviren (schleimbehüllte Viren mit besonderen Eigenschaften), die es in den Kategorien von A bis C gibt. Menschen sind von den Erregern A und B betroffen, während C nur auf Tiere übergreift. Immerhin, vor Kategorie C sind wir (wie lange noch?) sicher.
Es gibt Untereinheiten der Influenza-A, also verschiedene Erregertypen, die ähnlich aussehen und zusammen gesetzt sind. Influenza-B kommt nur in dieser einzigen Form vor. Influenza-A und auch B-Viren sind unter dem Elektronenmikroskop wahre Schönheiten. Sie sind kugelrund und verfügen über viele Noppen und Stacheln auf der Oberfläche. Leider können uns diese winzigen Schönheiten sehr krank machen und sogar zu Todesfällen führen.
Grippeviren sind extrem wandlungsfähig, Grippewellen in ihren erkennbaren Symptomen entsprechend unterschiedlich: Bauchgrippen mit Schwächegefühl und Durchfall, Schnupfen, Angina und Bronchitis bis zur Lungenentzündung können als Ausformungen der Grippe in Erscheinung treten.
Ein jeweiliges Virus, ein störendes Antigen, wird durch seine jeweiligen Antikörper bzw. immunkompetenten Lymphozyten definiert. Antigene besitzen so genannte antigene Determinanten zur Reaktion mit den Immunprodukten, wie etwa bei der Antigen-Antikörperreaktion.
Der Mediziner Dr. Johann Georg Schnitzer weist in seinen Publikationen auf die zahlreichen Möglichkeiten hin, sich unter Verzicht auf ein Übermaß an Medikamenten gegen Grippe zu schützen.
Wie äußert sich eine „echte Grippe“?
Besonders auffällig ist oft ein schneller, fast rasender Krankheitsverlauf. Die Symptome treten schnell und heftig auf. Nicht jeder Erkrankte entwickelt die volle Symptomatik aber alle auftretenden Symptome sind stark ausgeprägt. Charakteristisch sind schnell ansteigendes Fieber mit einer Körpertemperatur über oder gleich 38,5°C, trockener Reizhusten und starke Halsschmerzen mit Halskratzen, Muskelschmerzen am ganzen Körper und Kopfschmerzen.
Ergänzend treten meistens eine allgemeine Schwäche des Gesamtorganismus auf, Schweißausbrüche und Kälteschauer wechseln sich ab und sogar Übelkeit, Erbrechen und Durchfall können den Influenza infizierten Menschen heimsuchen.
Zu den bereits genannten Symptomen gesellen sich gern noch Kurzatmigkeit oder Luftnot, meist bedingt durch verschleimte Atemwege (so versucht Ihr Immunsystem die Viren los zu werden), starke Müdikeit und Abgeschlagenheit und Wassermangel. Wichtig ist viel zu trinken, mindestens 25ml pro Kilogramm Körpergewicht am Tag sollten es sein. Wenn der Urin klar ist, ist die Menge passend, ist er dunkel, wurde viel zu wenig getrunken. In extremen Fällen, müssen die betroffenen Personen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Dort wird dann auch gerne man mit „antiviralen Medikamenten“ behandelt. Was ich von diesen „Antiviralen-Mitteln“ zu halten habe, weiß ich spätestens seit der gigantischen Tamiflu-Lüge.
Gleichzeitig greifen zahlreiche Ärzte immer noch reflexartig zu Antibiotika: „Es könnte ja sinnvoll sein, zwar nicht gegen die Grippe, aber eventuell auftretende bakterielle Infektionen könnten eingedämmt und verhindert werden, die durch das geschwächte Immunsystem ausbrechen KÖNNTEN. Und so wird munter weiter mit Antibiotika bei der Grippe weiter therapiert: mit den falschen Mitteln, und das trotz „evidenzbasierten“ Erkenntnissen, dass Antibiotika bei diesen Erkrankungen nicht indiziert sind. Antibiotika wirken, in dem sie die Zellkerne zerstören und die Bakterien an der Vermehrung hindern. Ein Verhüterli sozusagen. Viren haben keinen Zellkern, deswegen können Antibiotika ihnen nichts anhaben.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen Praxis-Newsletter mit den „5 Wundermitteln“ an:
Kleine Anmerkung: Die Sache mit den „5 Wundermitteln“ ist mit Abstand der beliebteste Newsletter, den meine Patienten gerne lesen…
Von der Ansteckung bis zum ersten Symptom (Inkubationszeit)
Die Zeit von der Ansteckung bis zum Ausbruch der Symptome kann 1-5 Tage betragen. Diese Zahlen variieren zum Teil sehr stark, aber in der Regel sind es zwei bis drei Tage.
Wichtig ist zu wissen, dass die Viren sich einige Zeit auf Oberflächen, in Lebensmitteln oder in der Luft halten können, ohne zerstört zu werden. In einem Callcenter könnten sich beispielsweise, über die gemeinsame Nutzung von vielen Headsets und Tastaturen, die Viren schnell an weitere Personen heften und diese infizieren. Viren leben besonders gerne in trockener Luft, die wir im Winterhalbjahr in fast jedem geschlossenen Raum vorfinden.
Wie genau funktioniert das mit der Ansteckung?
Influenza-Viren sind vor allem durch Tröpfchen- und Schmierinfektionen übertragbar.
Sollte in der Bahn jemand niesen oder husten, kommen abertausende Viren „auf die Welt“ und möchten es gerne bei einem anderen Menschen warm und kuschelig haben.
Ausreichend ist auch die gemeinsame Berührung von Türklinken oder anderen Oberflächen, die von infizierten angefasst wurden. Das anfassen allein überträgt die Krankheit nicht, aber welcher Verschnupfte hat schon antiseptische Hände, muss nicht niesen und verbraucht keine Unmengen an Taschentüchern?
Wenn in Ihrer Familie eine Person erkrankt ist, versuchen Sie Körperkontakt zu vermeiden, lüften Sie regelmäßig die Räumlichkeiten und versuchen die Luft, z.B. durch Raumbefeuchter, zu befeuchten. An Influenza erkrankte Personen sind durchschnittlich etwa 4 oder 5 Tage ansteckend. Die Symptome halten jedoch oft noch Wochen danach an, vor allem was Schwäche und Lethargie betrifft.
Gegen Grippe impfen lassen? Grippemittel einnehmen?
Viren verändern rasant ihre Gestalt. Was im einen Winter hochaktuell war, kann schon im nächsten Frühjahr zum wertlosen Impfstoff werden.
Bei vielen Grippe-Kombipräparaten überwiegen die Nebenwirkungen aus meiner Sicht den tatsächlichen Nutzen. Und die nebenwirkungsreichen Antibiotika wirken bei bakteriellen Infektionen, nicht jedoch bei Viruserkrankungen. Ich lasse mich auf keinen Fall gegen Grippe impfen. Warum, beschreibe ich etwas genauer im Beitrag: Grippeschutzimpfung. Und noch mehr im Beitrag: Grippeimpfung, das medizinische Lottospiel. Es wird immer toller, was uns angepriesen wird.
Wie sagt man dann der Grippe den Kampf an?
Ein bloßes Vorhandensein von Grippeviren im Körper bedeutet nicht, dass man an Grippe erkrankt. Eine gesunde Abwehr ist sehr wohl imstande, diese Eindringlinge unschädlich zu machen, noch bevor sie sich überhaupt vermehren.
Eine geschwächte Immunabwehr hingegen ist eine willkommene Einladung an die Erreger: Auf einem geeigneten Nährboden können sie ungehinderte Vermehrung betreiben, – die Grippe ist da. „Le germe n’est rien, le terrain est tout!“ (Der Keim ist nichts, der Nährboden alles) urteilte der französische Arzt und Physiologe Claude Bernard (1813-1878) bereits im 19. Jahrhundert.
Dennoch wird mancherorts sogar die generelle Existenz von Viren angezweifelt: Gensequenzen aus der Nahrung, etwa durch den Verzehr von Geflügel- oder Schweinefleisch bevölkern demnach die menschlichen Zellen. Artspezifische Hyaluron-Säuren, schwefelhaltige Bausteine des Bindegewebes, die mit dem Verzehr von Fleisch aufgenommen werden, sollen außerdem die Abwehr-Reaktionen unseres Immunsystems hervorrufen. Letzteres wird über den Umstand belegt, dass es während einer Grippeerkrankung zu einer Zunahme an Hyaluronidase innerhalb des Bindegewebes kommt: Das Gewebe wird quasi „verflüssigt“ und ausgeschieden, nach der Genesung zeigt sich das Bindegewebe straffer als zuvor.
Außerdem erleiden sich von Schweinefleisch ernährende Sportler, aber auch andere Menschen schneller Risse von Sehnen und Bändern – schuld sind nach Ansicht mancher meiner Kollegen die Bestandteile des schwefelreichen, weichen Schweinebindegewebes, die mit der Nahrung aufgenommen wurden.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen Heilfasten-Newsletter dazu an:
Epidemien auf dem Vormarsch
Einig ist man sich allerdings über die Bedeutung des Nährbodens für die Entwicklung von Grippeerkrankungen und -epidemien. So forderte die Grippeepidemie von 1917 bis 1918 30 Millionen Tote. Während der Lebensmittelknappheit im Ersten Weltkrieg zeitigte ein unterschiedlicher Umgang der Dänen wie der Deutschen mit dieser Problematik gravierende Folgen: Während drei Millionen Dänen Getreide und Kartoffeln verzehrten, statt sie an die Schweine zu verfüttern, ernährte man sich in Deutschland von Schweinefleisch und den wenig eiweißreichen Zuckerrüben. Der dänische Schweinebestand dagegen ging um ein Fünftel zurück, die Sterblichkeit unter den Dänen um 17 Prozent.
Heute gehen einige Experten davon aus, dass Grippeviren in Schweinen und in Geflügel quasi übersommern, – die Zellen des Atmungsbereichs des Schweins verfügen über Rezeptoren für Viren der Vogelgrippe ebenso wie für Influenzaviren beim Menschen. Infiziert man sich mit beiden Virentypen, ist mit einer Kombination des genetischen Materials beider zu rechnen: Geboren sind neue, extrem gefährliche Virenarten.
Man könnte meinen, diese weitreichenden Erkenntnisse und Erfahrungen wären von der Wissenschaft aufgegriffen worden – weit gefehlt. Stattdessen entwickelte man nebenwirkungsbelastete, unzureichend wirksame Grippeimpfungen.
Die deutschen 300.000 Opfer der Epidemie von 1917/18 hatten also praktisch den Nährboden Schweinefleisch und den bedrohlichen Grippevirus zu sich genommen, Mangelernährung und Impfversuche hatte ihr Übriges getan.
Auch im Herbst 1999 wurde vor einem neuartigen, Grippetypus, verursacht durch mutierte Geflügelviren, gewarnt, der sich über den globalen Flugverkehr rasant ausbreiten sollte und den ein Drittel aller Infizierten nicht überlebte. Der Herbst 2005 brachte eine neue Epidemie: Die Vogelgrippe, die sich von Asien vermutlich über infizierte Zugvögel verbreitete. Aus der Türkei wurden Grippefälle des Befalls durch H5N1 bekannt, wirkliche Bedrohung oder nur Medienhype zur Vermarktung neuer Grippemedikamente und -impfstoffe? Wie sollte ein schwer infiziertes Tier in der Lage sein, noch mehrere Tausend Kilometer zurückzulegen?
Auch bei anderen Formen der Infektion spielt der Nährboden eine wichtige Rolle: Der Forscher und Arzt Max von Pettenkofer (1818-1901) trank eine Lösung mit aktiven Cholerabakterien, ohne anschließend krank zu werden, während Leprakranke pflegende Ärzte und Krankenschwestern selten an Lepra erkranken. Eine Ernährungsumstellung bewirkte darüber hinaus ein beschleunigtes Abheilen der Lepra-Geschwüre, wie Dr. Schnitzer mittels einer Studie in den 1980er Jahren in Sri Lanka belegt. Dennoch verbleibt die Lepra-Heilung fest in den Händen der Pharmaindustrie, die mit den bazillenbekämpfenden, die Geschwulste jedoch kaum vermindernden Lepramedikamenten z. B. in Äthiopien jährlich über eineinhalb Millionen Euro umsetzt.
Kinderlähmung ist ein weiteres Beispiel: Experten in den USA empfahlen eine zuckerfreie, vorbeugende Diät, die im Feldversuch erfolgreich erprobt wurde; Neuerkrankungen gingen deutlich zurück. Trotzdem setzte sie sich nicht durch: Man verabreichte die Schluckimpfung, Zucker blieb marktfähig. Sie glauben das mit der „Schädlichkeit“ von Zucker nicht? Dann lesen Sie bitte mal meinen Beitrag: Die giftige Wahrheit über Zucker und Übergewicht.
Mittel gegen Viren
2008: Schweinegrippe. Auf einmal wurde ein Medikament „berühmt“ und von Regierungen in aller Welt (die es sich leisten wollten oder konnten) millionenfach eingelagert: Tamiflu. Die Tamiflu-Kampagne spricht für sich. In vielen Ländern wurde dieses in den Medien hochgelobte, aber nebenwirkungsreiche Mittel reißend abgesetzt. Wenn Sie das Thema Tamiflu interessiert, lesen Sie unbedingt meinen Beitrag: Tamiflu – begehrt aber wirkungslos? und:Die Tamiflu – Lüge. Einfach unglaublich, was uns manchmal so alles erzählt wird…
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen Praxis-Newsletter mit den „5 Wundermitteln“ an:
Kleine Anmerkung: Die Sache mit den „5 Wundermitteln“ ist mit Abstand der beliebteste Newsletter, den meine Patienten gerne lesen…
Naturheilkunde, Alternativmedizin & Hausmittel
Im Folgenden finden Sie Hilfe und Hausmittel aus der Naturheilkunde und der Alternativmedizin, die bei einer Grippe oder grippalem Infekt in Frage kommen.
Da das Thema durchaus komplex und umfangreich ist, habe ich dazu ein kleines Büchlein verfasst: Die biologische Therapie der Grippe und grippaler Infekte, inklusive Erkältungen:
So, jetzt aber vorab einige praktische Tipps aus der Naturheilkunde.
Eine gesunde, artgerechte Ernährung schafft die nötigen Voraussetzungen: Naturbelassenes wird verzehrt, Denaturiertes und stark Erhitzes und Oxidiertes gemieden. Hinsichtlich der Anatomie seines Gebisses gehört der Mensch zu den Fruivoren, den Essern von leistungssteigernden, gesunden Samen, Früchten und Wurzeln; seine Nahrung sollte daher u. a. aus Hülsenfrüchten, Wurzelgemüsesalaten, Nüssen und Obst bestehen (vgl. Schnitzer-Intensivkost, Schnitzer-Normalkost).
Meiden Sie daher Nahrungsmittel und Zubereitungen wie:
-
isolierte Kohlenhydrate, Auszugsmehl und Industriezucker
-
raffinierte, extrahierte Produkte wie Säfte und Trockenfrüchte,
-
tierische Nahrungsmittel wie Fleisch, Wurst, Geflügel, (außer Hühnerbrühe), Fisch und Muscheln,
-
-
Zwingen Sie sich auf keinen Fall zum Essen. Ein paar Tage überleben Sie ohne Essen. Meiden Sie auf jeden Fall Süßigkeiten, Weißmehlprodukte und Schweinefleisch, sowie Käse und Milchprodukte.
Essen Sie Obst: z.B. einen geschälten Apfel und Möhren (evtl. gedünstet).
Die Sekundären Pflanzenstoffe in Pflanzenteilen sind entzündungshemmend. Besonders ratsam sind Kurkuma, Oregano, Zimt und Nelken. Daneben sind Heilpilze wie Reishi, Shitake und Maitake hilfreich. Fermentierte Lebensmittel wie Sauerkraut und Miso stärken die Körperabwehr ebenfalls.
Ein gutes Hausmittel ist auch eine Hühnerbrühe, aber nur frisch gekocht – keine Tütensuppen! Hühnereiweiß enthält die schleimlösende Aminosäure Cystein in reichhaltigen Mengen. Am besten auch keines dieser Hybrid-Turbo-Masthühner, sondern ein „normal“ gewachsenes. So etwas bekommt man eigentlich nur auf einem Markt. Mehr dazu auch in meinem Beitrag: Eier-Tanz um Antibiotika Hühner.
Knoblauch enthält organische Schwefelverbindungen, die antibiotisch und entzündungshemmend sind. Der reichliche Verzehr des Lauchgewächses soll einigen Studien zufolge sogar Tamiflu überlegen sein. Dies betrifft auch die Prophylaxe der Influenza. Bei Appetit-Mangel während einer Grippe ist Knoblauchsuppe ideal.
Warum geht der Appetit zurück? Das Lymphsystem im Bauchraum wird für die Ausscheidung ungewollter Substanzen gebraucht. Flüssigkeiten wie Nasensekret, Schleim und Schweiß werden in akuter Reaktion ausgeschieden. Sie sollten jetzt sehr viel mineralarmes Wasser oder schweißtreibenden Lindenblütentee trinken. Auch Einläufe mit Wasser auf Körpertemperatur können die Ausscheidungsvorgänge unterstützen.
Tees mit Vitalstoffen und Antioxidantien sind zur Begleitung der Behandlung immer sinnvoll. Bei Grippe haben sich Heißgetränke mit Holunderbeeren, Ingwer, Schafgarbenkraut, Lindenblättern, Pfefferminze und Wasserdost bewährt. Die Wirkstoff-Kombination in Propolis unterstützt das Immunsystem und hemmt Entzündungs-Prozesse. Extrakte aus Olivenblättern oder in Form von Tees sind traditionelle Mittel bei Infektionen.
Speziell dazu lesen Sie unter: Homöopathie bei Grippe, Erkältung und Fieber;
Als Komplexmittel: Infludo (von Weleda)
Empfohlene Tagesdosis:
5g – 10g Vitamin C (Ascorbinsäure) in Wasser auflösen und trinken, jedoch nicht abends, weil Sie dann vielleicht nicht schlafen können. Die Vitamin C Menge können Sie so lange erhöhen, bis sich ein leichter Durchfall einstellt. Ein Tipp ist auch Apfelstücke mit Vitamin C bestreuen. Mehr dazu auch im Beitrag: Einfluss von Vitamin C auf das Immunsystem.
Auch Vitamin D hat sich in Studien als sehr gute Vorbeugung gegen Grippe (und einfache Erkältungen) erwiesen. Bei einer Supplementierung mit Vitamin D ist der Bedarf an Vitamin K2 erhöht, das ebenfalls ergänzt werden muss! Des Weiteren hilfreich: Colostrum und Probiotika
Zink ist ein für das Immunsystem essentielles Spurenelement. Es sollte in einer Dosis von mindestens 50 mg täglich zugeführt werden. In Form von Zink-Sirup ist das Mineral am besten bioverfügbar.
Quentakehl D5 Tropfen und Notakehl D5 Tropfen jeweils 2 mal 10 Tropfen täglich. Sanuvis: 3 mal 20 Tropfen täglich Sanukehl Serra D6 Tropfen zwei mal 5 Tropfen täglich einreiben oder einnehmen. Rilvora Komplex: täglich zwei mal 10 Tropfen in die Ellenbeuge einreiben. Wenn die Grippe nicht richtig ausheilen will zusätzlich Utilin S D6 täglich einmal 5 Tropfen einreiben.
Die Grippe wird durch ein saures Milieu (siehe Übersäuerung) begünstigt.
Sonstiges
Weitere hilfreiche Maßnahmen beschreibe ich u.a. auch im Beitrag: Immunstimulation bei Erkältung, Schnupfen, Abwehrschwäche.
Ansonsten schauen Sie auch unter den entsprechenden Beiträgen: Erkältung, Husten und Schnupfen. Dort beschreibe ich weitere Maßnahmen.
Ausreichend Schlaf, Sport, die Vermeidung von Stressoren und Entspannungsverfahren fördern die Aktivität des Immunsystems.
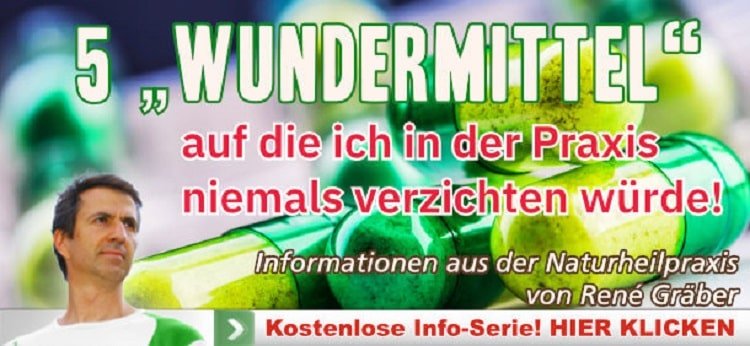
Beitragsbild: 123rf.com – Iakovenko