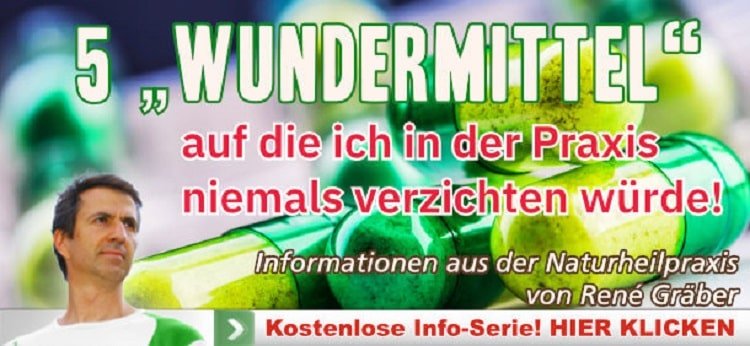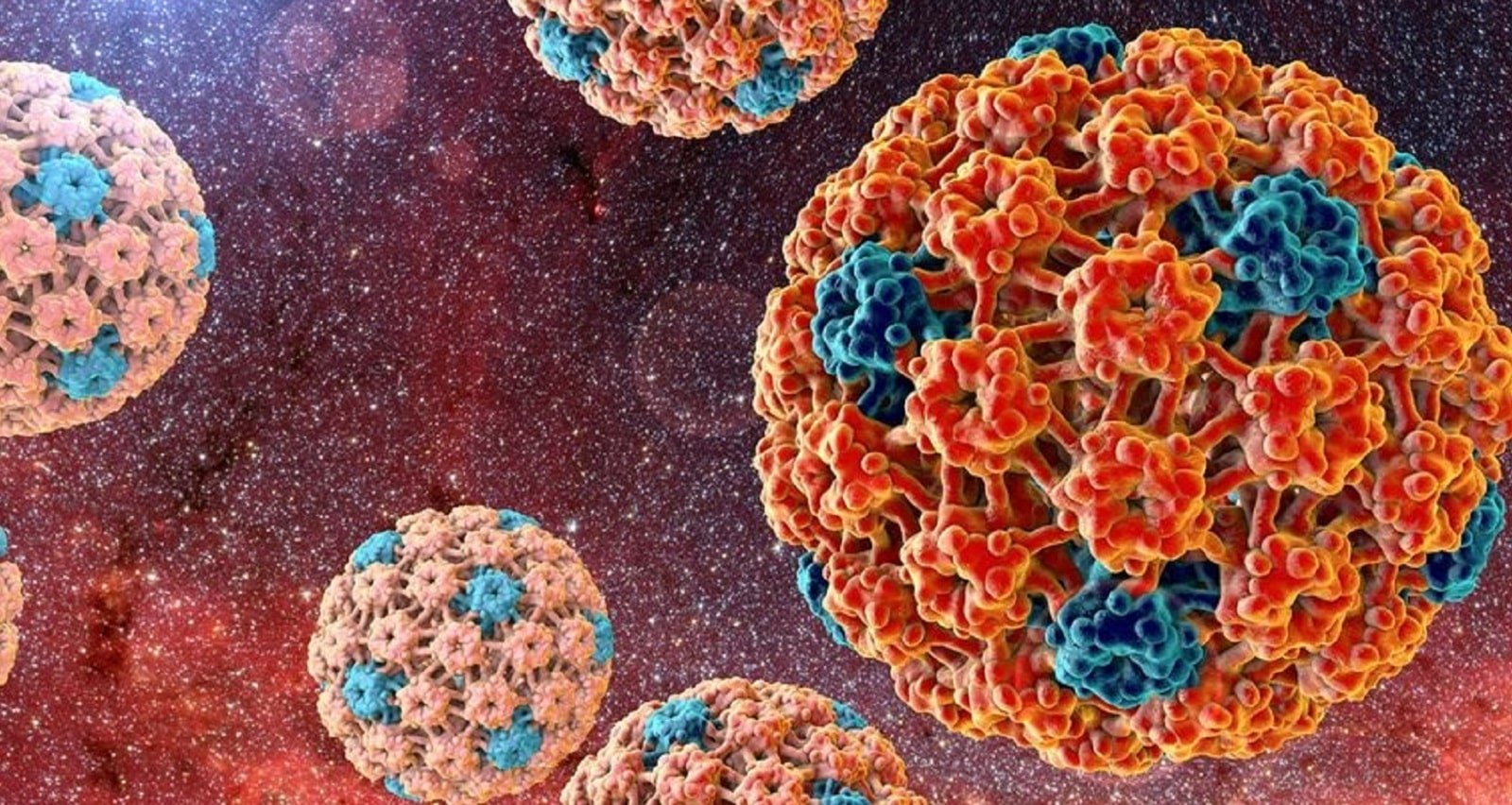ASEA und die Redox-Signal-Moleküle aus der Flasche
Redox-Signal-Moleküle sind freie Radikale, ROS (Reactive Oxygen Species) und elektrochemisch aktive Oxide des Stickstoffs, wie Stickstoffmonoxid (NO), die als biologische Botenstoffe arbeiten.
Ein Beispiel für solche ROS sind Wasserstoffperoxid und Hyperoxid. Andere Moleküle, wie Kohlenmonoxid, gehören ebenfalls zur Klasse der Redox-Signal-Moleküle.
Wie es scheint, steht man in der Wissenschaft erst am Anfang, die Bedeutung und Wirkweise dieser Moleküle als Signalmoleküle zu verstehen. Die Entstehung solcher freien Radikale als Signalmoleküle ist von biotischen und abiotischen Stresssignalen abhängig.
Die Redox-Signal-Moleküle, wie Wasserstoffperoxid und andere ROS, verändern Zielproteine, indem sie deren Schwefelgruppen oxidieren und dadurch Schwefelverbindungen (Disulfidbrücken) schaffen. Durch die neue Struktur ergibt sich gleichfalls eine veränderte Funktion des betroffenen Proteins.
Stickstoffmonoxid ist ebenfalls so ein freies Radikal und Signalmolekül. Der Organismus produziert das Molekül durch NO-Synthasen (NOS). Dieses Enzym kommt hauptsächlich in den Endothelzellen der Blutgefäße vor und ist für die Steuerung der Weitstellung (Dilatation) der Blutgefäße verantwortlich.
Große Mengen an NO werden durch die Makrophagen produziert, die im Falle einer Infektion vor Ort das Molekül als Waffe und weniger als Signalmolekül einsetzen. Für die Produktion von diesen großen Mengen an NO liegt ein modifiziertes NOS, das sogenannte iNOS, vor. Das iNOS wird auch nur dann aktiviert, wenn Endotoxine und entzündungsfördernde Zytokine vorliegen.
Um hier keine oxidative Schäden im Organismus zu verursachen, muss die Wirksamkeit der Redox-Signal-Moleküle lokal höchst spezifisch sein. Diese lokale Spezifität wird durch eine lokal begrenzte Produktion des Moleküls erreicht, in unmittelbarer Nähe des Wirkorts. Zudem ist die Lebensdauer der freien Radikale extrem kurz, bedingt durch ihr hohes Reaktionspotential. Als Signalmoleküle sind sie daher auch nicht in der Lage, über weite Strecken zu wandern, obwohl ihre geringe Größe dies begünstigen würde.
Wenn man sich die wissenschaftliche Literatur zu diesem Thema anschaut, dann wird immer wieder betont, dass das Wissen um die Wirkmechanismen der Redox-Signal-Moleküle noch sehr begrenzt ist. Auch die Bedeutung der Antioxidantien in diesem Zusammenhang ist noch nicht vollkommen klar. Wie es aussieht, ist die wirkortspezifische Produktion der Redox-Signal-Moleküle der Schlüssel für deren biologisch-positive Wirksamkeit. „Ausreißer“ würden von den Antioxidantien abgefangen, vorausgesetzt es sind ausreichend viele von ihnen vor Ort.
ASEA – Eine neue Firma, ein neues Nahrungsergänzungsmittel – Redox-Signal-Moleküle aus der Flasche
ASEA ist eine amerikanische Network-Marketing-Firma, die für sich in Anspruch nimmt, als erste und einzige Hersteller Redox-Signal-Moleküle in die Flasche gebannt zu haben.
Nach einer 17-jährigen Forschungszeit ist es angeblich gelungen, die Instabilität der Signalmoleküle so zu beeinflussen, dass sie in der Flasche in einer stabilen Form vorliegen.
Einmal eingenommen, erhöhen sie die Konzentrationen von Redox-Signal-Molekülen im gesamten Organismus und beeinflussen somit die Effektivität der Zellfunktionen zum Positiven.
So weit, so gut. Allerdings fielen mir sofort eine Reihe von Fragen dazu ein.
Bei meinen Recherchen zu diesem Thema stieß ich auf eine Arbeit aus dem Jahr 2000 (Microbicidal activity of MDI-P against Candida albicans, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, und Legionella pneumophila).
Laut Webseite von ASEA ist MDI-P eine Art Vorgängerprodukt, dass von ASEA verbessert worden ist. MDI-P ist eine sterile Kochsalzlösung, bei der über elektrolytische Verfahren zahlreiche hochreaktive Chlor- und Sauerstoffspezies (freie Radikale) erzeugt worden sind. Getestet wurde dann in vitro die anti-mikrobielle Wirksamkeit dieser Lösung gegen die in der Überschrift aufgeführten Pathogene.
Da es sich hier um freie Radikale handelte, die sich in erhöhter Konzentration vorfanden, war das Ergebnis nicht weiter überraschend: MDI-P zeigte sich als besonders schnell wirksames Breitbandantibiotikum. Die Autoren bemerkten aber, dass es keine Daten für den in-vivo-Einsatz gibt und dessen möglicher negativer Einfluss auf Körpergewebe, Morbidität, Mortalität. Daher ist, auch aufgrund der geringen Herstellungskosten, MDI-P ein interessantes Sterilisations- und Desinfektionsmittel.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter dazu an:
Und genau hier häufen sich meine Fragen an dieses Präparat.
Redox-Signal-Moleküle werden vom Organismus ganz in der Nähe des Zielorts produziert, da sie sonst anderweitig als freie Radikale aktiv werden und Schäden anrichten.
Woher wissen die ASEA Redox-Signal-Moleküle, dass sie nicht nur in der Flasche sich ruhig zu verhalten haben?
Denn spätestens wenn sie getrunken werden und sich im Mund befinden, sind sie von organischem Material umgeben. Aber auch hier sollen sie noch inaktiv sein. Weiter geht die Reise durch Speiseröhre, Magen-Darm-Trakt, Leber, Blutgefäße hin zu den Zielzellen. Bis hier dürfen die Moleküle „keinen Mucks“ von sich geben, denn sonst würde es Schäden durch oxidativen Stress ohne Ende geben.
- Wenn die Moleküle es dann bis in die Zielregion geschafft haben, gibt es dann hier Enzyme, die die inaktiven, „stabilisierten“ Redox-Signal-Moleküle aus der Flasche aktivieren?
- Um welche Enzyme handelt es sich dann?
- Oder gibt es eine ganz andere Lösung für dieses Problem?
Ich habe keine Arbeit bei der ASEA Dokumentation finden können, die mir diese Frage hätte beantworten können.
Das, was an wissenschaftlicher Dokumentation beigefügt worden ist (myaseaonline.info/asea.net/USEnglish/
safetystudiesfullstudies/ASEA_Safety_Studies_
with_full_study_links.pdf), beschränkt sich bei der Sicherheitsfrage auf Tierstudien mit Mäusen, Hunden etc., deren Zahl selten die Zahl 20 überschritt. Es gibt auch eine Arbeit, die die Leistungssteigerung des Produkts bei Sportlern belegen soll (myaseaonline.info/asea.net/USEnglish/
WhitePaperVTUSENG.pdf). Es handelt sich hier um eine Arbeit ohne Plazebokontrolle und mit nur 18 Probanden, eine extrem übersichtliche Zahl, wie ich denke.
Reaktionen im Internet
Unter http://fraudbytes.blogspot.com/2010/08/my-experience-with-asea.html beschreibt ein Radsportler seine Erfahrungen mit dem Präparat. Darin erfuhr er, nach eigenen Aussagen, eine leichte Leistungsminderung. Dies soll natürlich kein besonders gutes „Argument“ gegen das Präparat sein. Denn selbst der Autor war sich bewusst, dass er keine repräsentative Auswahl als Proband darstellt. Seine Aussage steht aber im absoluten Kontrast zu den 100-prozentig positiven zahlreichen Webseiten der Networker, die das Produkt für den Hersteller vertreiben.
Im folgenden Forum (auf englisch https://cassiopaea.org/forum/threads/asea-scam.25302/) befasst man sich ebenfalls mit den Redox-Signal-Molekülen aus der Flasche. Hier bemängelt ein Chemiker, dass ASEA keine Angaben über die Natur der fraglichen Moleküle macht. Ich hatte auch keine Angaben diesbezüglich entdecken können. Auch die Behauptung, dass diese stabilisierten Redox-Signal-Moleküle die Antioxidantien um 500 Prozent aktivieren würden, ist fragwürdig.
azulpublicidad.com war eine Webseite, die sich mit diesem Thema befasste und wie man die Leistungsfähigkeit von Antioxidantien steigern kann. Die Redox-Signal-Moleküle werden hier jedoch nicht genannt. Denn die Wirksamkeit von Antioxidantien hängt von der Zahl ihrer freien Elektronen ab: Je mehr freie Elektronen, umso effizienter ist der anti-oxidative Effekt. Da aber Redox-Signal-Moleküle freie Radikale sind, würden sie die Zahl der Elektronen bei den Antioxidantien verringern und damit die Wirksamkeit reduzieren. Also auch hier gibt es noch einen ausgiebigen Klärungsbedarf.
Das Geschäftsmodell
Was mich verwundert hat, war, dass als Gründer von ASEA nicht ein einziger Wissenschaftler aufgeführt wird.
Bei einem so wissenschaftlichem Thema würde ich einen Wissenschaftler als Ideengeber und -umsetzer vermuten. Statt dessen handelt es sich bei den Gründern um Top-Manager aus der amerikanischen Lebensmittel-, Finanz- und Telekommunikationsindustrie. Der Vorsitzende im Aufsichtsrat war zuvor ein Top-Manager für Marketingstrategien bei Kraft Foods.
Jetzt wird das einzige Produkt von ASEA über eine MLM-Struktur vertrieben, ein binäres Vertriebssystem. Man kann für oder gegen MLM sein. Ich denke, dass es sowohl bei der klassischen Geschäftsführung als auch beim MLM schwarze und weiße Schafe gibt, und dass man auf keinen Fall die eine oder andere Form prinzipiell ablehnen sollte. Aber es gibt Vorlieben, die man auch nicht kritisieren kann. So ist es denkbar, dass es eine Reihe von Leuten gibt, die sich mit einem Produkt nur deshalb nicht beschäftigen wollen, da es über eine MLM-Organisation vertrieben wird.
Fazit
Die Redox-Signal-Moleküle aus der ASEA-Flasche lassen im Moment für etwas kritischere Geister einfach noch zu viele Fragen und Ungereimtheiten offen, als dass ich dieses Produkt in Bausch und Bogen befürworten könnte.
Beitragsbild: 123rf.com – Vladimir-Soldatov