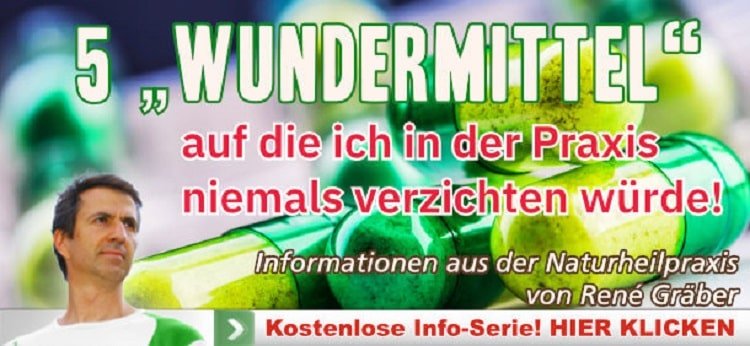Kaum zu glauben, dass solche Medikamente noch verordnet werden! Die Nebenwirkungen gravierend.
Ja, es ist schwer zu glauben, was da “passiert”. Und bevor ich zu den Antidepressiva komme, vorab etwas zu der Erkrankung, gegen diese verordnet werden: Depressionen.
Es ist nicht zu leugnen, dass schwere Depressionen Hand in Hand gehen mit einem erhöhten Suizidrisiko (Selbstmordrisiko).
Laut Statistik werden ca. 40 Prozent der Depressiven versuchen, Selbstmord zu begehen, wovon fast 10 Prozent „erfolgreich“ tödlich enden.
Da Depressionen medizinisch als Erkrankung angesehen werden, ist es nur folgerichtig, dass solche Patienten medizinische und medikamentöse Betreuung erhalten. Besonders bei der medikamentösen Behandlung scheint sich aber die Depressionsbehandlung von einer z.B. antihypertensiven Medikation (gegen Bluthochdruck) prinzipiell zu unterscheiden.
Der Vorteil bei Blutdrucksenkern: Man kann messen, ob der Blutdruck sinkt – oder eben nicht. Während also Antihypertensiva durchaus eine objektive Wirkung auf den erhöhten Blutdruck zeigen, scheinen die Antidepressiva fast so gut bzw. so schlecht wie keine Therapie (verglichen mit Placebo) in der Suizidprävention zu sein.
Sind Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) die besseren Antidepressiva?
Zwar scheint eine Studie über den Effekt von Serotonin-Wiederaufnahmehemmern (SSRIs) eine Wirkung zu belegen. Doch schon die Autoren weisen auf 2 Einschränkungen hin: Die Medikamente helfen nur sehr schwer erkrankten Patienten. Mittel- oder niederschwellige Depressionen werden kaum gelindert. Zudem kamen auch in dieser Untersuchung schwere Nebenwirkungen zutage.
So ist auch der Einsatz von Lithium bei bipolaren Krankheitsformen deutlich effektiver bei der Suizidprävention als eine Kurz- oder Langzeitapplikation von Antidepressiva.
Diese Fakten sollten zum Nachdenken anregen. Zwar ist in Deutschland die Selbstmordrate nahezu konstant, während sie in den USA stark gestiegen ist. 2016 nahmen sich dort 70 % mehr junge Mädchen das Leben als noch 2010.
Seit etwa 20 Jahren zeichnet sich aus klinischen Studien, Versuchen mit gesunden Probanden, Fallserien etc. ab, dass insbesondere die selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) die Suizidtendenzen verstärken. Diese zeigten im Vergleich zu Placebos, dass sie die Häufigkeit von Ängsten und Aggressivität verdoppeln.
Diese Befunde waren in einer Studie aus 2016 besonders bei Kindern und Jugendlichen zu beobachten (Suicidality and aggression during antidepressant treatment: systematic review and meta-analyses based on clinical study reports).
Eine weitere Studie belegt, dass SSRIs die Neigung zu Suizid und Gewalttaten um den Faktor 2 erhöhen. So lautet das Ergebnis einer Meta-Analyse aus 2016 über 130 Einzel-Studien. Bemerkenswert ist dabei, dass die analysierten Arbeiten an gesunden Erwachsenen durchgeführt wurden. Es kann sich hier also nicht um Begleit-Symptome einer Depression handeln (Precursors to suicidality and violence on antidepressants: systematic review of trials in adult healthy volunteer).
Eine andere Nebenwirkung ist nicht dazu angetan, eine positive Gesamtwirkung zu entfalten: SSRIs lösen sexuelle Dysfunktionen aus. Eine Untersuchung offenbarte, dass die Störung bei rund 60 % aller Patienten auftrat, die ein Präparat aus der Klasse der SSRIs eingenommen hatten (Incidence of sexual dysfunction associated with antidepressant agents: a prospective multicenter study of 1022 outpatients. Spanish Working Group for the Study of Psychotropic-Related Sexual Dysfunction). Kann man so Depressionen heilen?
Die Grund-Probleme der Studien
Pharma-Studien am Menschen vergleichen einen Wirkstoff mit dem Effekt eines Placebos. Damit weder Prüfärzte noch die Teilnehmer unvoreingenommene Bewertungen vornehmen, werden die Daten „verblindet“. Das heißt, Ärzte und Teilnehmer wissen nicht, wer Verum oder Placebo erhält. Doch die Nebenwirkungen der Antidepressiva sind so prägnant, dass die Prüfärzte fast immer ahnen, wer zu welcher Gruppe gehört.
Die Mediziner sind nicht mehr unabhängig in der Beurteilung. Wahrscheinlich merken sogar die Teilnehmer, ob sie Verum oder Placebo eingenommen haben, sodass sie im Interview vorurteilsgeleitete Angaben machen (Deadly Psychiatry and Organised Denial)
In einer Studie versuchten Wissenschaftler diesen Fehler zu vermeiden. Die Placebos enthielten Wirkstoffe, (z.B. Atropin) die zu ähnlichen Nebenwirkungen führen wie die Antidepressiva. Dies hatte zur Folge, dass nur noch sehr schwache antidepressive Wirkungen des Verums nachgewiesen werden konnten (Active placebos versus antidepressants for depression).
In vielen Studien über Antidepressiva nehmen Freiwillige teil, die bereits in der Vergangenheit Antidepressiva eingenommen haben. Es ist keineswegs auszuschließen, dass diese Menschen noch unter Entzugserscheinungen leiden, weil das Medikament abgesetzt wurde. Genau das kam in einer dänischen Meta-Studie heraus. Doch in der Placebo-Gruppe schien man diese Beschwerden keineswegs als so schlimm zu empfinden, dass die Teilnehmer die Studien reihenweise abbrachen.
Das „wahre Medikament“, das „Verum“, veranlasste vielmehr zum Abbruch der Teilnahme: Die Zahl der Abbrecher war unter Verum um 12 % höher als unter Placebo. Die Wissenschaftler kamen zu dem Ergebnis, nachdem sie 71 Zulassungs-Studien überprüft hatten (Drop-out rates in placebo-controlled trials of antidepressant drugs: A systematic review and meta-analysis based on clinical study reports). Die insgesamt über 67.000 Seiten enthielten Daten von mehr als 18.000 Patienten.
Die Autoren merken zudem an, dass die Lebensqualität der Studien-Teilnehmer viel zu wenig berücksichtigt wurde. Das bedeutet: Wesentliche Daten fehlen! Als ein Wissenschaftler der Arbeitsgruppe den dänischen Gesundheitsminister darauf ansprach, konnte/wollte der Politiker seinen Standpunkt natürlich nicht ändern. Die Studien gäben eine Verbesserung der Lebensqualität her. Was er nicht sagte: Von 131 Studien wurde in nur 3 Arbeiten überhaupt nach dem wichtigen Haupt-Kriterium geforscht.
Durch die Entzugserscheinungen kommt eine weitere Verzerrung hinzu. Bekommen die Teilnehmer ein anderes Antidepressivum als vor der Studie, empfinden sie das Verschwinden der Entzugs-Symptome natürlich als positiv. Und weil es ihnen besser geht, denkt der Prüfarzt: „Das Antidepressivum schlägt an.“ (Deadly Psychiatry and Organised Denial)
Eine andere Verzerrung der Studien-Ergebnisse kommt dadurch zustande, dass viele Freiwillige die Studie beendeten, weil sie die Nebenwirkungen als unerträglich empfanden. Zudem kommt die Beurteilung der Lebens-Qualität der Teilnehmer in den Studien oft zu kurz. Die aktive Teilnahme am sozialen Leben ist allerdings ein allgemeingültiges Kriterium der Erkrankung (Selective serotonin reuptake inhibitors, and serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors for anxiety, obsessive-compulsive, and stress disorders: A 3-level network meta-analysis).
2002 hat der Psychotherapeut Irving Kirsch von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) die Herausgabe aller Studienergebnisse zu Antidepressiva verlangt. Dazu gehörten auch Daten aus nicht veröffentlichten Studien, die die Pharmaproduzenten der FDA übermitteln müssen. Der Wissenschaftler stellte zunächst fest, dass die Hälfte aller dieser Studien nicht veröffentlicht worden war. Die Analyse der gesamten Daten ergab, dass 57 % der Antidepressiva unwirksam waren. 82 % aller genannten Wirkungen beruhten auf dem Placeboeffekt (Antidepressants and the Placebo Effect).
Irving Kirsch konnte dieses Resultat in einer weiteren Studie verifizieren (Initial Severity and Antidepressant Benefits: A Meta-Analysis of Data Submitted to the Food and Drug Administration)
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter dazu an:
Die amerikanische Arzneimittelbehörde (FDA) reagiert
Die FDA (Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde) sah sich 2007 genötigt, einen besonderen Warnhinweis für Antidepressiva und deren Einsatz bei Kindern, älteren Minderjährigen und Erwachsenen herauszugeben.
Eine englische Expertengruppe des britischen Commitee on Safety of Medicines erhob eine Nutzen-Schaden-Relation für eine Reihe bekannter Antidepressiva. Sie kamen, ähnlich wie die FDA, zu dem Schluss, dass neben fehlender therapeutischer Wirksamkeit eine Erhöhung der Suizidbereitschaft als Nebenwirkung (oder Hauptwirkung) zu beobachten war.
Aber nicht nur die Selbsttötungsrate sollte uns aufhorchen lassen. Auch gehen Studien davon aus, dass Antidepressiva die Arterien verdicken können und so das Risiko für Herzerkrankungen und Hirnschlag erhöhen.
Diese Nebenwirkung tritt nicht nur bei SSRI, sondern ebenso durch andere Antidepressiva auf.
Im August 2011 stellte die FDA bereits fest, dass der SSRI Celexa in hohen Dosen zu Herz-Rhythmus-Störungen führen kann. Gleichzeitig konnten Studien zeigen, dass eine tägliche Dosis von mehr als 40 mg sowieso keinerlei zusätzlichen Nutzen für die Patienten bedeutet, obwohl Ärzte oft mehr verschreiben (FDA Drug Safety Communication: Abnormal heart rhythms associated with high doses of Celexa (citalopram hydrobromide)
Eine groß angelegte Studie zeigt einen deutlichen Anstieg von Hirnschlag bei Frauen in den Wechseljahren, wenn diese ein SSRI einnehmen (Antidepressant use and risk of incident cardiovascular morbidity and mortality among postmenopausal women in the Women’s Health Initiative study).
Zahlreiche weitere Untersuchungen kommen zu ähnlichen Ergebnissen auch in anderen Patientengruppen (unter anderem Atypical antipsychotic drugs and the risk of sudden cardiac death).
Weitere ernstzunehmende Nebenwirkungen der Antidepressiva sind:
- Erhöhtes Risiko für Totgeburten
- Verstärkte Gewaltbereitschaft
- Erhöhte Gefahr, an Diabetes zu erkranken
- Spröde Knochen
- Negative Effekte auf das Immunsystem
- Erhöhtes Risiko für eine spätere Depression
- Geistiger Verfall durch Langzeiteinnahme
Depressive Verstimmungen
Depressive Verstimmungen lassen sich nach der (inzwischen überholten) Theorie in vielen Fällen auf einen Mangel an Serotonin zurückführen. Antidepressiva wirken diesem Mangel entgegen, doch bringen sie dabei den menschlichen Serotonin-Haushalt oftmals stark durcheinander.
Dieses Hormon Serotonin ist nämlich nicht nur für die Stimmungslage, sondern auch für viele andere Körperfunktionen wichtig. Die weitreichenden Folgen der Medikamente sind daher kaum abzuschätzen.
Alle oben erwähnten Nebenwirkungen lassen sich wahrscheinlich darauf zurückführen, dass die Regulation und Aktivität des Serotonins durch die Arzneistoffe gestört wird.
Die einseitige Betrachtung der Gehirn-Chemie führt ohnehin nicht zum Ziel, wenn man die Ursachen der Erkrankung erkennen will. Es ist wohl ein ganzes Bündel von Faktoren, die Depressionen auslösen. Viele davon sind rein psychologischer Natur wie etwa der Verlust eines nahestehenden Menschen, Beziehungs-Probleme oder Stress. In den USA zeigte sich auch, dass trotz weit verbreiteter Anwendung der Medikamente keine Reduzierung der Erkrankungshäufigkeit eingetreten ist.
Eine Ursache für Depressionen wird oft übersehen. Es gibt eine ganze Reihe von Medikamenten, die Depressionen als Nebenwirkung zeitigen. Dazu zählen beispielsweise Protonenpumpenhemmer, H2-Antagonisten, Antazida, Betablocker, Kontrazeptiva, Antikonvulsiva (Gabapentin), Kortikosteroide (Prednison), Allergie-Medikamente und Ibuprofen sowie einige andere Schmerzmittel.
Insgesamt sind es über 200 Präparate, die Depressionen fördern oder sogar alleine verursachen. Das zeigte eine Langzeitstudie mit mehr als 26.000 Teilnehmern. 7 % der Menschen, die ein solches Medikament einnahmen, erkrankten an Depressionen. Hingegen betrug die Erkrankungsrate bei der Einnahme von zwei der riskanten Mittel schon 9 % der infrage kommenden Teilnehmer.
Wenn die in der Studie untersuchten Menschen drei oder mehr Medikamente mit der Nebenwirkung „Depression“ anwendeten, war die Wahrscheinlichkeit für die Erkrankung dreimal höher als bei Menschen, die zwar ebenso viele, aber in dieser Hinsicht nicht riskante Mittel einnahmen.
Interessant ist auch das Ergebnis der Studie zu den an Teilnehmern, die Antidepressiva und gleichzeitig Medikamente einnahmen, die Depressionen verursachen. In dieser Gruppe war die Häufigkeit der Depressionen dreimal höher als bei Menschen, die Antidepressiva nahmen, darüber hinaus aber nur Mittel, die Depressionen nicht fördern. Die Autoren sehen in diesem Ergebnis einen weiteren Grund, warum Antidepressiva oft gar nicht anschlagen (Prevalence of Prescription Medications With Depression as a Potential Adverse Effect Among Adults in the United States).
Der Studienschwindel der Pharma-Marketer
Der SSRI von Eli Lilly, Fluoxetin, konnte gegenüber Placebo eine tendenziell erhöhte Suizidneigung zeigen. Fluoxetin wird zur Behandlung von Depressionen, Zwangsstörungen und Bulimie eingesetzt. Er kommt zudem als Ergänzung zu einer Psychotherapie zur Reduktion von Essattacken und selbstinduziertem Erbrechen zur Anwendung.
Trotz der nicht gerade überzeugenden Ergebnisse zweier Studien kommt Lilly zu einem positiven Ergebnis. Man sah dann den Erfolg des Präparats plötzlich, als man die primäre Zielsetzung der Untersuchungen umdefinierte und so statistische Relevanzen erzwang.
In weiteren Versuchen, das Wirkprofil von SSRIs und trizyklischen Antidepressiva abzuschätzen, wurden Metaanalysen und Fall-Kontrollstudien bemüht. Nach Sichtung der Datenlage wurden, trotz großzügiger Dateninterpretation, keine relevanten Unterschiede zu Placebo in der therapeutischen Wirksamkeit erkannt.
In einer Meta-Analyse wird zudem deutlich, dass bei nur 345 von 702 Studien Suizidversuche als Beurteilungskriterium in Sachen Wirksamkeit und Nebenwirkung aufgenommen worden sind. In den placebokontrollierten Studien wurde sogar eine Verdoppelung des Suizidrisikos unter SSRI-Gabe deutlich. Ähnliches gilt für die trizyklischen Antidepressiva, deren Suizidrisiko mit dem der SSRI vergleichbar ist.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter dazu an:
Vor allem wenn Sie für den Erhalt der Homöopathie sind, sollten Sie sich unbedingt dazu eintragen, denn die „Politik“ und etablierte Medizinerschaft ist bestrebt die Homöopathie zu verbieten und / oder abzuschaffen!
Daten fallen einfach unter den Tisch
Eine weitere Meta-Analyse von 477 klinischen Studien kommt ebenfalls zu keinen besseren Ergebnissen, eher geschönten, mit statistisch frisierten Vertrauensbereichen. Man kann daraus auch schließen, dass bei weniger erweiterten Vertrauensbereichen ein erhöhtes Suizidrisiko auch in diesen Studien nicht auszuschließen ist. Alles in allem deutet vieles darauf hin, dass Daten und Ereignisse nicht komplett dokumentiert worden sind, sodass der objektive Aussagewert aller dieser Erhebungen äußerst fragwürdig ist.
Dies wird umso deutlicher, als in der ersten Meta-Analyse nur publizierte Studien berücksichtigt wurden. Damit fällt alles Negativ-Material, dass den Weg in den Papierkorb fand, aus der Beurteilung heraus, eine Praxis, die für SSRI-Studien nicht unbekannt ist.
Aber nicht nur Negativ-Befunde fallen unter den Tisch. Die Studiendesigns und Basisdaten werden von den Firmen und Betreibern schon im Vorfeld so zurechtgebogen, dass das gewünschte Ergebnis zum guten Schluss auch herauskommt. So werden Suizidversuche gezielt fehlklassifiziert, indem z.B. diese Ereignisse in der „Wash-out-Phase“ der Placebogruppe zugeordnet werden. Ein anderer Trick besteht darin, diese Ereignisse fehlzukodieren, also statt Suizidversuch nur emotionale Labilität zu notieren.
Auch über die Auswahl der Probanden/Patienten kann eine interessierte Vorselektion vorgenommen werden. So werden Drogenkonsumenten, akute Suizidalität und ähnliche Diagnosen ausgeschlossen. Aufgenommen werden primär Patienten, von denen man weiß, dass sie ein erwünschtes Reaktionsmuster auf die zu prüfende Substanz zeigen. Das Studiendesign, ein weiterer interessierter Punkt, ist dann auch nicht auf eine Erfassung solcher „Störungen“ ausgelegt und schaut blind über alles hinweg, was mit Suizid zu tun haben könnte.
Heute weiß man, dass die Firma Lilly bewusst kritische Daten verschwiegen hat. Kritische Forscher, die das Risikopotential anders als die Firma eingeschätzt hatten, wurden privat und professionell unter Druck gesetzt.
Teure Placebos
Signifikant höhere Nebenwirkungsraten von SSRIs und/oder trizyklischen Antidepressiva sind das Eine, aber möglicherweise keine positive therapeutische Wirkung derselben das Andere. So gibt es ernstzunehmende Hinweise, dass Präparate, wie Citalopram, Fluoxetin, Nefazodon (außer Handel), Paroxetin, Sertralin und Venlafaxin eine therapeutische Wirksamkeit entfalten, die zwischen 68 und 89 Prozent auf einem Plazeboeffekt beruht.
Möglicherweise ist der therapeutische Effekt noch geringer und der Placeboeffekt noch ausgeprägter, weil bei der Sichtung des Datenmaterials eine Reihe von Studien unberücksichtigt blieb, die keinerlei therapeutische Effizienz feststellen konnten.
Eine wissenschaftlich wichtige Größe in der Beurteilung der biologischen oder biochemischen Aktivität einer Substanz ist die Dosis-Wirkungsrelation. Diese ist unglaublicherweise für die Psycho-Medikamente vollkommen unbekannt.
Das heißt für die Praxis, dass ich bei mangelndem Effekt nicht weiß, ob eine Dosissteigerung zu einem therapeutischen Ergebnis führt oder ob ich nicht einfach die Nebenwirkungen erhöhe, ohne den Patienten zu therapieren. Da die antidepressiven Pharmamarketer dies wissen, initiieren sie acht klinische Studien, von denen dann zwei (zufällig) positiv ausfallen. Diese beiden Studien sind für die Zulassung bei der FDA notwendig, die anderen sechs gehen den Weg alles Vergänglichen.
Denk ich an Deutschland in der Nacht….
Für Reboxetin von der Firma Pfizer war nur eine Studie von acht positiv, ein Grund, warum die Substanz in den Staaten nicht zugelassen wurde. Dafür aber in Deutschland…. Das IQWiG forderte daraufhin von Pfizer Studienmaterial und –unterlagen zur Bewertung an, die Pfizer schlicht verweigerte. Im November letzten Jahres kam das IQWiG zu dem Schluss, dass das Pfizersche Präparat keinerlei therapeutischen Nutzen habe.
Nicht nur in Hollywood wird mit Träumen eine Menge Geld gemacht. Wer hätte vermutet, dass die hochwissenschaftliche Pharmaindustrie Hollywood in dieser Angelegenheit locker in die Tasche steckt.
Depressionen sanft heilen
Auch wenn die Pharmaindustrie uns nur zu gerne in dem Glauben lässt, dass wir täglich einen Medikamentencocktail schlucken müssen, um aus einer Depression herauszukommen, so gibt es doch einige sanfte Alternativen, die ganz ohne Nebenwirkungen auskommen. Da diese Methoden aber keinen Profit bringen, werden sie den Patienten fast immer verschwiegen:
Falls Sie Medikamente nehmen, kontrollieren Sie die Beipackzettel, ob hier Depressionen als Nebenwirkung aufgelistet sind. Am besten sprechen Sie Ihren Arzt darauf an, um die riskanten Mittel zu ersetzen.
Minimieren Sie stark Ihren Zuckerkonsum und streichen Sie Getreide sowie verarbeitete Nahrungsmittel weitestgehend von Ihrem Speiseplan. Zucker facht nicht nur entzündliche Prozesse an, sondern führt auch zu mitochondrialer Dysfunktion, die besonders die Nervenzellen beeinträchtigt. Das Immunsystem reagiert mit der Ausschüttung von Zytokinen, die ebenfalls zerebrale Störungen und induzieren. Zudem sinkt die Sensibilität für Cortisol (Inflammatory activation is associated with a reduced glucocorticoid receptor alpha/beta expression ratio in monocytes of inpatients with melancholic major depressive disorder).
Dieses Stresshormon schützt den Körper vor den Folgen der chronifizierten Entzündungen.
Vermeiden Sie auch künstliche Süßstoffe sowie Gluten und Weizenkeim-Agglutinin.
Probiotische Lebensmittel, wie fermentiertes Gemüse und Kefir, bauen die Darmflora auf, was sich positiv auf den gesamten Körper auswirkt. Eine gesunde Darmflora ist unter anderem essenziell für die geistige Gesundheit. Über die Darm-Hirn-Achse beeinflusst die Darmflora auch Prozesse im Gehirn. Auch an dieser Stelle können Entzündungen indirekt auf die Gehirntätigkeit einwirken. Es ist nachgewiesen, dass Menschen mit chronischen Magen-Darm-Entzündungen und Autoimmunkrankheiten verstärkt zu Depressionen neigen ([Role of gastrointestinal inflammations in the development and treatment of depression]).
Vitamin B12 wirkt sich positiv auf die Stimmung aus. Wissenschaftler stellten fest, dass Patienten mit Depressionen häufig an einem Vitamin B12-Mangel leiden.
Ein zu niedriger Vitamin-B-9-Spiegel (Folsäure) kann die Wahrscheinlichkeit, an Depressionen zu erkranken, enorm steigern (Dietary folate and the risk of depression in Finnish middle-aged men. A prospective follow-up study).
Daneben sollte auf eine gute Versorgung mit den Vitaminen B1, B2, B3 und B6 geachtet werden.
Gleiches gilt für Vitamin D, das Sie ganz einfach beim regelmäßigen Spaziergang in der Sonne auftanken können. Ein Vitamin-D-Mangel spielt nachgewiesenermaßen bei der saisonal-affektive Störung („Winterdepression“) eine entscheidende Rolle (Vitamin D deficiency is associated with low mood and worse cognitive performance in older adults).
Tierische Omega-3-Fettsäuren sind wichtige Bestandteile des Gehirns, die sich auch auf das Gemüt positiv auswirken. Besonders die Aufnahme der Docosahexaen-Säure (DHA) aus Fettfischen und Krill sollte optimal erfolgen.
Das Gesamt-Cholesterin und das „schlechte“ LDL-Cholesterin sollten nicht zu niedrig sein. Forscher stellten fest, dass dies mit aggressivem Verhalten und einem erhöhten Selbstmord-Risiko verbunden ist (Low total cholesterol and low-density lipoprotein associated with aggression and hostility in recent suicide attempters).
Natrium ist essenziell für das Gehirn. Natürliches Salz enthält nicht nur Natrium, sondern zusätzlich viele andere Mikronährstoffe. Studien zeigen immer wieder, dass regelmäßige Bewegung und tägliche Fitnessprogramme einer Depression effektiv entgegenwirken.
Versuchen Sie, die Exposition gegen elektromagnetische Felder (EMF) so gut es geht zu minimieren. Tragen Sie Ihr Handy nicht direkt am Körper, schalten Sie Stand-by-Geräte ab.
Praktizieren Sie Entspannungsübungen. Bei Depressionen besonders bewährt hat sich die Emotional Freedom Technique. Ausreichend Schlaf und regelmäßige Erholungsphasen sind wichtig, um den Hormonhaushalt ins Gleichgewicht zu bringen und einer Depression entgegenzuwirken.
Beitragsbild: 123rf.com – Sergey-Nivens
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen Praxis-Newsletter mit den „5 Wundermitteln“ an:
Kleine Anmerkung: Die Sache mit den „5 Wundermitteln“ ist mit Abstand der beliebteste Newsletter, den meine Patienten gerne lesen…
Dieser Beitrag wurde letztmalig am 09.10.2024 aktualisiert und ergänzt.