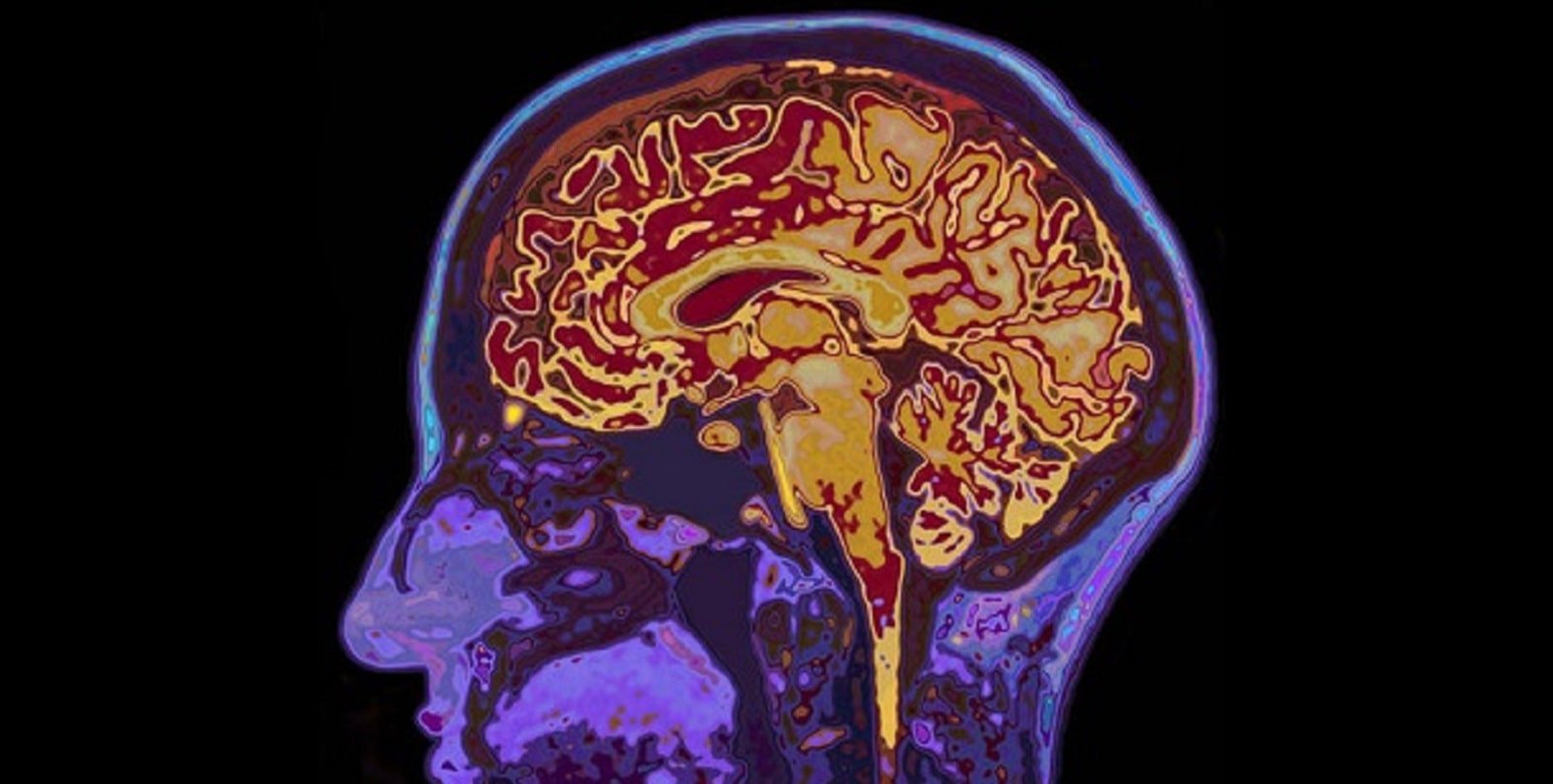Herzrhythmusstörungen & Vorhofflimmern ganzheitlich angehen [aus der Naturheilpraxis]
Aus der Naturheilpraxis von René Gräber / Kategorie: Krankheiten/Beschwerden, Herzprobleme
Manchmal reicht ein einziger Aussetzer – ein Schlag zu viel oder zu wenig – und das Herz erinnert uns daran, dass es nicht selbstverständlich ist, Tag für Tag im Takt zu bleiben. In meiner Arbeit seit Ende der 90er habe ich unzählige Menschen gesehen, bei denen Herzrhythmusstörungen nicht einfach „Schicksal“ waren, sondern das Ergebnis eines ganzen Geflechts aus Mineralstoffmängeln, nervöser Überlastung, alter Entzündungsherde oder Medikamentennebenwirkungen.
Das Faszinierende: Oft lassen sich diese Störungen durch gezielte Schritte beruhigen – mit Heilpflanzen wie Weißdorn oder Herzgespann, mit einer durchdachten Versorgung an Magnesium, Kalium und Coenzym Q10, mit Akupunktur oder einfachen, aber wirksamen Entspannungsverfahren. Wer versteht, welche Stellschrauben es gibt, kann sein Herz nicht nur stabilisieren, sondern auch seine Lebensqualität spürbar zurückholen.
Welche Formen von Herzrhythmusstörung gibt es?
Das Herz hat einen eigenen Schrittmacher (= Sinusknoten), der den Herzrhythmus steuert und mit dem Atrioventrikular-Knoten (AV-Knoten) in Verbindung steht. Die durchschnittliche Schlaganzahl pro Minute (= Puls) liegt in Ruhe bei 60.
Es gibt langsame (= bradykarde) und schnelle (= tachykarde) Rhythmusstörungen. Ein Beispiel für eine bradykarde Rhythmusstörung ist der AV-Block (= Atrioventrikular-Block), bei dem eine Erregungsüberleitungsstörung zwischen Herzvorhof und Herzkammer besteht. Eine Tachykardie kann entweder in den Vorhöfen (supraventrikulär) oder in den Herzkammern (ventrikulär) ihren Ausgang nehmen.
Ist der Herzschlag unregelmäßig, spricht man von einer Arrhythmie. Grundsätzlich kann es bei jeder Herzrhythmusstörung zu einem akuten Aussetzen der effektiven Herzleistung kommen, d.h. das Herz ist nicht mehr in der Lage, genügend Blut durch den Körper zu pumpen. So kann es unter Umständen zu einem ausgeprägten Sauerstoffmangel kommen. Verlaufen die Herzschläge sowohl zu rasch oder zu langsam und sind gleichzeitig unregelmäßig, spricht der Mediziner von Tachyarrhythmie oder Bradyarrhythmie.
Herzrhythmusstörungen können aber auch harmlos sein und vom Betroffenen unbemerkt bestehen. So kommen vorübergehende Herzrhythmusstörungen zum Beispiel häufig bei Jugendlichen vor.
Eine krankhafte Ursache lässt sich hier meist nicht finden. Man vermutet, dass Wachstumsschübe dafür verantwortlich sind, wenn das Herz gelegentlich aus dem Tritt kommt. In solchen Fällen verschwinden die Probleme nach einiger Zeit von selbst wieder.
Gelegentliche, zusätzliche Herzschläge (Extrasystolen) kommen bei fast jedem Menschen hin und wieder vor und sind nicht bedenklich. Wenn ab und zu ein Herzschlag ausbleibt, muss man sich auch keine Sorgen machen.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter „Unabhängig. Natürlich. Klare Kante.“ dazu an:
Häufigste Variante: Vorhofflimmern
Die häufigste Variante der Herzrhythmusstörungen ist das Vorhofflimmern. Alleine an dieser Form der Erkrankung litten 2020 weltweit über 37 Millionen Menschen. 1 % bis 2 % der US-Bürger sind daran erkrankt. Dabei sind nur 0,1 % der unter 55-Jährigen betroffen, aber 6,4 % der 65 bis 69 Jahre alten Menschen. Mehr als ein Viertel aller über 85-Jährigen leiden an der Herzkrankheit.
Die Störung geht von den neuronalen Schrittmacherzentren des Herzvorhofes aus. Die Zusammenarbeit zwischen diesen Triggern der Herztätigkeit und dem übergeordneten Sinusknoten funktioniert nicht mehr richtig.
Infolgedessen kommt es dann zu unregelmäßigen Kontraktionen, wodurch sich im Blutvolumen des Herzens kreisende Verwirbelungen bilden. Dadurch wiederum können Blutklümpchen, sogenannte Thromben, entstehen.
Das passiert bei 100 von Vorhofflimmern betroffenen Patienten bei vier Patienten innerhalb eines Jahres. Diese Blutgerinnsel können, wenn sie ins Gehirn gelangen, einen Schlaganfall (= Hirninfarkt) verursachen. Jedes Jahr werden fast 200.000 Deutsche wegen Vorhofflimmern in eine Klinik eingewiesen.
Jeder fünfte Schlaganfall geht auf ein nicht erkanntes Vorhofflimmern zurück. In den Anfangs-Stadien des Vorhofflimmerns bemerken die Patienten keine oder nur geringe Symptome. Doch auch ohne Schlaganfall kann das Gehirn beeinträchtigt werden. So droht bei lang anhaltendem Vorhofflimmern eine beschleunigte Hirnalterung.
Ursachen
Herzrhythmusstörungen können durch eine Vielzahl von Faktoren entstehen – von organischen Erkrankungen über Stoffwechselstörungen bis hin zu äußeren Einflüssen. Ich will hier nur eine Aufzählung liefern:
Herzerkrankungen: Koronare Herzkrankheit, Herzklappenfehler, Herzmuskelerkrankungen, zurückliegende Herzmuskelentzündungen (z. B. nach Virusinfekten).
Hormonstörungen: Schilddrüsenüberfunktion (häufige Tachykardien), Schilddrüsenunterfunktion (Bradykardien).
Blutarmut: z. B. durch Eisenmangel – verschlechtert die Sauerstoffversorgung des Herzmuskels.
Lungenerkrankungen: Asthma, COPD oder Erkrankungen der Lungenvenen.
Medikamente (gar nicht so selten!): Zahlreiche Wirkstoffe können den Herzrhythmus beeinflussen, z. B.:
- Diuretika („Wassertabletten“) → Kalium- und Magnesiummangel
- Digitalispräparate → Überdosierung kann Rhythmusstörungen auslösen
- Bestimmte Antibiotika und Antimykotika → Verlängerung des QT-Intervalls
- Antidepressiva, Neuroleptika, Stimulanzien → Einfluss auf Herzfrequenz und Reizleitung
- Schilddrüsenhormone und Corticoide → Veränderung des Mineralstoffhaushalts
- Betablocker, Calciumantagonisten → Pulsverlangsamung bis Bradykardie
- und nicht zuletzt auch diese sogenannten „Corona-Impfungen“ (neuartige Gentechnik-Medikamente!!)
Wichtig: Bei neu auftretenden Rhythmusstörungen immer prüfen, ob zeitnah ein neues Medikament begonnen oder die Dosis verändert wurde.
Vitalstoffmängel: Vor allem Kalium, Magnesium und Calcium. Langfristige Defizite stören die Reizleitung und fördern Rhythmusstörungen (siehe Naturheilkunde-Teil weiter unten).
Chronische Übersäuerung: Kann Mineralstoffverluste fördern und das Herz belasten. Dazu auch weiter unten gleich mehr.
Mitochondriale Dysfunktion:
- Mitochondrien – die „Kraftwerke der Zellen“ – sind in Herzmuskelzellen besonders zahlreich.
- Vorhofflimmern führt zu Energiemangel, verstärkter Milchsäurebildung, vermehrtem oxidativem Stress und Entzündungsprozessen.
- Schädigung der Natrium- und Calcium-Kanäle sowie gestörte Neubildung von Mitochondrien verstärken den Teufelskreis.
Psychische Faktoren: Lang anhaltender Stress, Trauer, Ängste oder Sorgen können das Herz aus dem Takt bringen – oft vermittelt über das vegetative Nervensystem.
Stimulanzien: Übermaß an Koffein (insbesondere Energy Drinks) kann Herzrhythmusprobleme auslösen.
Aus der Praxis: Nicht selten sehe ich, dass mehrere Faktoren gleichzeitig wirken – etwa ein leichter Kalium- und Magnesiummangel, kombiniert mit einem neuen Medikament und einer Phase hohen Stresses. Erst wenn man diese Ebenen parallel angeht, wird das Herz wieder dauerhaft ruhig.
Symptome
Die unregelmäßigen Füllungen des Herzens und unregelmäßigen Blutauswürfe der Herzkammer führen dann im fortgeschrittenem Stadium zu Blutdruckschwankungen, die man als Schwindel, Schwitzen und Schwäche empfindet. Zudem verspüren die Patienten Herzrasen sowie kurzzeitige Bewusstseinsverluste oder Benommenheit. Das anfallsartige Vorhofflimmern bei jüngeren Patienten (paroxysmales Vorhofflimmern) dauert oft nur maximal 48 Stunden.
Neben dem Schwindel merken die Patienten selbst auch eine gewisse Kurzatmigkeit sowie eine deutlich nachlassende Leistungsfähigkeit. Der unregelmäßige Herzschlag ist aber das sicherste Erkennungszeichen.
Auch das Kammerflimmern ist wie das Vorhofflimmern sehr gefährlich. Die unregelmäßige Aktivität der Hauptkammern des Herzens kann im schlimmsten Fall zum plötzlichen Herzstillstand und damit meist zum Tod führen.
Die Sprache der Symptome
Das Herz ist mehr als eine Pumpe – es ist der Taktgeber unseres Lebens, der nicht nur Blut, sondern auch Freude, Liebe und Lebensenergie zirkulieren lässt. Wenn es aus dem Rhythmus gerät, kann das eine Botschaft sein: „Etwas in deinem Leben ist aus dem Gleichgewicht.“
Ein unregelmäßiger Herzschlag kann darauf hinweisen, dass wir uns zu sehr unter Druck setzen oder uns im Strom des Alltags verloren haben. Vielleicht ist es der stille Wunsch, aus einem engen Rhythmus – dem sprichwörtlichen Hamsterrad – auszubrechen.
Manchmal reagiert das Herz, wenn wir zu lange gegen unsere inneren Gefühle leben. Unterdrückte Emotionen, nicht gesprochene Worte oder ungelöste Konflikte können sich in Herzklopfen, Herzstolpern oder einer beschleunigten Frequenz ausdrücken. Das Herz „spricht“ dann zu uns, um uns zu erinnern, wieder auf unsere innere Stimme zu hören.
Fragen, die man sich stellen darf / könnte:
- Lebe ich im Einklang mit meinem eigenen Lebensrhythmus oder nur im Takt äußerer Erwartungen?
- Wo halte ich an etwas fest, das meinem Herzen nicht guttut?
- Gibt es Gefühle, die ich seit Langem zurückhalte?
In diesem Verständnis wird die Herzrhythmusstörung nicht nur als Störung, sondern auch als Einladung gesehen – zur Rückkehr in einen gesunden, liebevollen Rhythmus mit uns selbst.
Schulmedizinische Therapie
In der konventionellen Behandlung stehen vor allem zwei Medikamentengruppen im Vordergrund: Antiarrhythmika zur Rhythmuskontrolle und Blutgerinnungshemmer zur Schlaganfallprophylaxe (z. B. Marcumar, Xarelto, Aspirin, Heparin). Diese Mittel können im akuten Notfall Leben retten – als Dauerlösung sind sie jedoch aus meiner Erfahrung oft problematisch.
Einige Substanzen, die in Studien interessante Ansätze zeigen, haben es bislang nicht in die gängigen Leitlinien geschafft. Dazu gehören:
- Probucol – eigentlich ein Lipidsenker, mit antioxidativen Effekten, im Tierversuch positiv bei Vorhofflimmern.
- DPP-4-Hemmer (aus der Diabetestherapie), Fibrate und das Tetrapeptid Elamipretid – alle mit Einfluss auf Entzündungs- und Energiestoffwechsel.
- Strophanthin – ein altbekanntes Herzmittel mit langer Tradition, heute fast vergessen, aber aus meiner Sicht zu Unrecht.
Wenn Medikamente nicht den gewünschten Effekt bringen, kommen interventionelle Verfahren infrage:
- Herzschrittmacher bei ausgeprägter Bradykardie
- Elektrische Kardioversion („Stromschlag“ unter Narkose), um das Herz wieder in den Sinusrhythmus zu bringen
- Pulmonalvenen-Isolation per Herzkatheter bei paroxysmalem Vorhofflimmern, um überaktive Nervenzentren zu veröden
- Operationen am Sinusknoten in sehr speziellen Fällen
Interessant ist eine kanadische Studie, die medikamentöse Procain-Infusion (15 mg/kg über 30 Minuten) mit elektrischer Kardioversion verglich: In 50 % der Fälle war Procain allein erfolgreich – die aufwendige Kardioversion war also nur bei der Hälfte der Patienten nötig. Das legt nahe, diese belastendere Methode in die zweite Reihe zu stellen.
Meine Erfahrung mit Antiarrhythmika: Diese Wirkstoffe werden oft großzügig verschrieben, doch ihr Nutzen ist begrenzt. Sie können selbst Rhythmusstörungen auslösen, haben teils gravierende Wechselwirkungen und verschlechtern mitunter eine bestehende Herzschwäche. Die Erfolgsquote ist alles andere als überzeugend.
Blutgerinnungshemmer – Risiko und Nutzen: Die neuen „modernen“ Präparate (NOAKs) werden gern als sicherer beworben, doch auch sie bergen Risiken: von schweren Blutungen bis zu Hirnblutungen. Hinzu kommt die Belastung für Leber und Nieren. Mehr dazu in meinem Beitrag: Xarelto – Mittel der Wahl oder Mittel der Qual?
Wichtig: Hinter jeder Herzrhythmusstörung kann eine andere, behandelbare Ursache stecken – von der Schilddrüse bis zur Elektrolytstörung. Diese Ursachen zu finden und zu behandeln, ist immer der erste Schritt, bevor Medikamente zur Dauerlösung werden.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter „Unabhängig. Natürlich. Klare Kante.“ dazu an:
Alternative Therapie, Hausmittel, Homöopathie & Co. bei Herzrhythmusstörungen
Nach meiner Erfahrung ist es selten nur eine Maßnahme, die das Herz wieder ruhig schlagen lässt. Meist braucht es ein Zusammenspiel aus Mineralstoffversorgung, gezielten Heilpflanzen, nervenberuhigenden Verfahren und einer Lebensführung, die den Herzmuskel entlastet. Genau hier setzt die Naturheilkunde an: Sie betrachtet nicht nur den Herzschlag, sondern auch das Umfeld, in dem er entsteht – von der Ernährung über den Stresspegel bis hin zu stillen Entzündungsherden.
Was folgt, ist kein „Alles-oder-nichts“-Plan, sondern ein Werkzeugkasten, aus dem wir gezielt auswählen: Je nach Ursache, Laborwerten und individueller Belastung. Manche Maßnahmen wirken sanft im Hintergrund, andere spürbar innerhalb weniger Tage. Gemeinsam bilden sie die Basis, die in der konventionellen Behandlung oft fehlt.
Im Folgenden stelle ich einige Verfahren vor die helfen können und an die ich denken wollen würde…
Akupunktur
Akupunktur kann bei Herzrhythmusstörungen eine wertvolle Ergänzung sein – besonders dann, wenn Stress, vegetative Dysbalancen oder funktionelle Störungen den Herzschlag aus dem Takt bringen. In der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) wird das Herz nicht isoliert betrachtet, sondern im Zusammenhang mit Kreislauf, Nerven und Emotionen („Shen“). Ziel ist es, den Energiefluss (Qi) zu harmonisieren und die Herzleitbahn zu stabilisieren.
Einsatzgebiete in der Praxis:
- Stress- und angstbedingtes Herzstolpern
- Funktionelle Tachykardien ohne strukturelle Herzschäden
- Begleitung bei Vorhofflimmern (zur Symptomlinderung, nicht als alleinige Therapie)
- Vegetative Übererregung mit Schlafstörungen
Typische / mögliche Punkte:
- PC6 (Neiguan): Beruhigt Herz und Geist, wirkt regulierend auf den Puls
- HT7 (Shenmen): Stärkt das Herz-Qi, stabilisiert die Herzfrequenz
- BL15 (Xinshu): Unterstützt Herzenergie und Kreislauf
- CV17 (Shanzhong): Fördert die Herz-Lungen-Funktion, löst Spannungen im Brustbereich
Behandlungsablauf:
- Meist 1–2 Sitzungen pro Woche in einer Serie von 6–10 Terminen
- Wirkung setzt bei funktionellen Störungen oft schon nach wenigen Behandlungen ein
- Bei chronischen oder stressassoziierten Formen ist eine begleitende Langzeitbetreuung sinnvoll
💡 Aus der Erfahrung: Viele Patienten berichten, dass sich nicht nur der Herzschlag stabilisiert, sondern auch innere Unruhe, Schlafprobleme und Blutdruckschwankungen deutlich bessern.
Entspannungsverfahren
Hier wird es gleich besonders spannend, denn kaum jemand weiß es oder glaubt daran…
Yoga (inkl. Atemarbeit): In einer prospektiven Studie an Patienten mit paroxysmalem Vorhofflimmern reduzierte Yoga die Episodenhäufigkeit, senkte Herzfrequenz und Blutdruck und verbesserte Angst/Depression. Praktisch relevant: weniger AF-Tage, bessere Lebensqualität.
Praxis: 2–3 Einheiten/Woche, Schwerpunkt auf ruhigen Sequenzen + Pranayama (keine Extrempositionen).
Langsames Atmen (Resonanzfrequenz ~6 Atemzüge/Min): Erhöht Baroreflex-Sensitivität und HRV, verschiebt das autonome Gleichgewicht Richtung Parasympathikus – das ist genau die Richtung, die wir bei Stress-getriggerten Rhythmusstörungen wollen.
Praxis: 10 Minuten, 1–2×/Tag; durch die Nase, betontes Ausatmen (z. B. 4–6 Sek. ein, 6–8 Sek. aus).
Progressive Muskelentspannung (PMR): Randomisierte/pilotierte Daten zeigen über Wochen eine Zunahme der HRV mit PMR (teils in Kombination mit Atemtraining). Übersetzt: bessere vagale Modulation, weniger „Zündeln“ im System.
Praxis: 20 Minuten, 3×/Woche; gut machbar auch bei älteren Patienten.
Autogenes Training: Mehrere Studien/metaanalytische Übersichten berichten reduzierte Stressmarker und Zunahme der HF-HRV-Komponente – also mehr parasympathische Aktivität. Praxis: 10–15 Minuten täglich; ideal als Abendroutine oder direkt nach dem Aufwachen.
Achtsamkeits-/Meditationsprogramme: Meta-Analysen zeigen insgesamt positive, aber heterogene Effekte auf HRV – sprich: es wirkt, aber die Qualität der Programme und die Übungstreue entscheiden. Für stressinduzierte Extrasystolen häufig hilfreich.
Praxis: 10–20 Minuten/Tag; einfache Atemfokussierung oder Body-Scan reichen oft.
EFT/Klopfakupressur: Klinische Studien (nicht immer RCT) zeigen kurzfristige HRV-Anstiege, Cortisolabfall und bessere Stresswerte. Für akute Anspannung/Episoden brauchbar, Evidenzbasis gemischt. Praxis: 5–10 Minuten bei aufkommender Unruhe; als Zusatz, nicht als Solo-Therapie.
Wichtige Hinweise aus der Praxis
- Zielgröße HRV: Wir steuern auf mehr vagale Aktivität. Das korreliert mit weniger Stress-Triggern für Arrhythmien. (Kein Garant, aber ein relevanter Hebel.)
- Dosierung in Wochen, nicht Tagen denken: Yoga/PMR/AT brauchen 4–8 Wochen bis zur vollen Wirkung – das ist normal.
- Atemtechnik mit Maß: In seltenen Fällen können sehr tiefe/manipulative Atemmanöver Extrasystolen triggern. Ruhig, nasal, ohne Pressatmung.
- Keine „Entweder-oder“-Frage: Entspannung ersetzt keine Abklärung (Elektrolyte, Schilddrüse, Strukturschäden), sie ergänzt – und stabilisiert oft genau die Patienten, die auf Stress reagieren.
Mein Favorit ist klar das Autogene Training.
Ernährung
Um die Herzrhythmusstörungen zu verbessern, ist eine basische Ernährung wichtig (weiter unten dazu mehr). Damit kann eine chronische Übersäuerung (die bei den meisten Menschen in unserer „modernen Kultur“ vorliegt) verbessert werden. Zucker sollte nur in sehr geringen Mengen oder am besten gar nicht verzehrt werden. Das säurebildende Lebensmittel ist riskant, weil es die Entzündungswerte in die Höhe treibt.
Um das Herz nicht übermäßig zu belasten, sollten Sie außerdem Übergewicht abbauen. Zu viele Kilos belasten das Herz und engen die Atmung ein. Mäßige Nahrungsaufnahme wirkt Blähungen entgegen, die auf den Hohlmuskel drücken (Roemheld-Syndrom). Eine gesunde Ernährung und ausreichende Bewegung sind immer noch die besten Mittel zu diesem Ziel.
Eine abwechslungsreiche Kost mit viel frischem Obst und Gemüse ist der beste Garant für eine optimale Versorgung mit Mineralien. Hülsen- und Nussfrüchte sowie Vollkorngetreide liefern viel Magnesium und Kartoffeln, Bananen und Trockenobst viel Kalium. Grüne Blätter wie Feldsalat und Spinat enthalten große Mengen Calcium.
Omega-3-Fettsäuren sind in guten Pflanzenölen enthalten. Hierhin gehören die Öle von Lein, Hanf und Chia.
Zuviel verarbeitete Lebensmittel sind Gift für das Herz. So kann das Phosphat in Wurst Herzrhythmusstörungen fördern.
Womöglich kann auch Histamin-Intoleranz Herzrhythmusstörungen Vorschub leisten. Dann ist eine entsprechende Diät erforderlich: Kein lange gereifter Käse, keine Schokolade und kein Rotwein.
Orthomolekular-Medizin
In meiner Praxis sehe ich immer wieder: Viele Herzrhythmusstörungen lassen sich nicht allein mit Tabletten oder Eingriffen in den Griff bekommen – erst wenn die Mineralstoff- und Mikronährstoffversorgung stimmt, wird das Herz wirklich stabil. Das Verrückte: Diese Basis wird in der Schulmedizin oft kaum beachtet.
Ich lasse bei Patienten mit Rhythmusstörungen immer die Werte im Vollblut bestimmen – nicht im Serum, das ist zu ungenau. Dort sieht man nur, was außerhalb der Zellen schwimmt, nicht, was im Herzmuskel selbst ankommt. Und gerade das zählt.
Kalium: Für die elektrische Stabilität des Herzmuskels unverzichtbar. Bei zu wenig Kalium „hüpft“ das Herz leichter aus dem Takt. Zielbereich im Vollblut: 3,5–5,5 mmol/l. Bei Mangel haben sich 1.500 mg Kaliumchlorid pro Tag bewährt, am besten als Retardpräparat in mehreren Portionen. Immer unter Kontrolle – zu viel kann ebenso gefährlich sein wie zu wenig.
Magnesium: Mein „Anti-Stress-Mineral“ fürs Herz. Entspannt Herz- und Gefäßmuskulatur und wirkt wie ein natürlicher Rhythmusstabilisierer. Optimal im Vollblut: 0,76–1,05 mmol/l. Bei Mangel 200–300 mg Magnesiumcitrat, verteilt über den Tag. Ohne genug Magnesium bleibt auch ein Kaliumdefizit oft bestehen.
Calcium: Braucht das Herz für den kräftigen, koordinierten Schlag. Defizite sehe ich meist in Verbindung mit Vitamin-D-Mangel oder einem ungünstigen Calcium-Phosphor-Verhältnis. Dosierung nur nach Laborwert.
Omega-3-Fettsäuren (EPA/DHA): Dämpfen Entzündungen, verbessern die Erregungsleitung in der Herzmuskelzelle. Ich setze meist 2–3 g täglich ein – am liebsten aus gereinigtem Fischöl oder Algenöl.
Coenzym Q10: Pflicht, wenn die Mitochondrien schwächeln – und das tun sie bei Herzproblemen fast immer. Ubiquinol ist hier die aktive Form. In der Praxis: 100–200 mg täglich.
L-Carnitin: Transportiert Fettsäuren in die Mitochondrien, damit das Herz genug „Brennstoff“ hat. Besonders wertvoll bei älteren Patienten oder Herzmuskelschwäche. Dosierung: 1–2 g täglich, verteilt.
Vitamin D: Ich sehe oft, dass niedrige Spiegel mit Herzrhythmusstörungen zusammenfallen. Zielbereich: 40–60 ng/ml. Die genaue Dosierung hängt vom Laborwert ab – pauschalieren bringt hier nichts.
Eisen: Ohne Eisen kein Sauerstofftransport – und damit keine stabile Herzarbeit. Ferritin und Hämoglobin immer checken, dann gezielt auffüllen.
Aus der Erfahrung: Bei einigen Patienten stabilisiert sich der Herzrhythmus deutlich, wenn Kalium und Magnesium im Optimalbereich sind und die Mitochondrien mit Q10 und L-Carnitin wieder genug Energie liefern. Diese Basis ist oft entscheidender als das nächste Antiarrhythmikum.
Heilpflanzen
In meiner Praxis setze ich Heilpflanzen gezielt ein – nicht als „Kräuterchen nebenbei“, sondern als ernstzunehmende Unterstützung für Herzrhythmus und Herzleistung. Entscheidend ist: Nur standardisierte Präparate verwenden – so ist die Wirkstoffmenge klar und die Wirkung reproduzierbar.
Weißdorn (Crataegus monogyna/laevigata): Mein Klassiker bei leichten Herzschwächen und instabilem Rhythmus. Weißdorn stärkt die Pumpleistung, verbessert die Durchblutung der Herzkranzgefäße und beruhigt ein nervöses Herz. Standardisiert auf 4–6 % Flavonoide oder 2,2 % Vitexin. In der Praxis: 300–900 mg pro Tag, verteilt auf 2–3 Dosen. Wirkung spürbar nach 6–12 Wochen – Geduld zahlt sich aus.
Herzgespann (Leonurus cardiaca): Ideal, wenn Stress oder Nervosität das Herz stolpern lassen. Beruhigt das vegetative Nervensystem und nimmt dem Herzen „den Druck von innen“. 1–2 ml Tinktur (1:5) 2–3× täglich oder 300–600 mg Trockenextrakt. Kuren von 4–8 Wochen haben sich bewährt.
Melisse (Melissa officinalis): Sanft, aber wirksam. Entspannt, löst Krämpfe und harmonisiert die Herzfrequenz bei nervösen Beschwerden. 2–3 Tassen Tee täglich (1–2 g Blätter pro Tasse, 5–10 Min. ziehen lassen) oder 300–500 mg Extrakt. Auch langfristig gut verträglich.
Grüner Hafer (Avena sativa): Tonikum fürs Nervensystem, das auch dem Herz zugutekommt. Besonders bei Erschöpfung oder funktionellen Herzrhythmusstörungen. 2–3 ml Tinktur 2× täglich oder 10–15 ml Presssaft. Kurdauer: 4–6 Wochen.
Granatapfel (Punica granatum): Kein „direktes Herzmittel“, aber ein starker Schutz für Gefäße und Herzmuskel durch Antioxidantien wie Punicalagin. Wirkt entzündungshemmend und gefäßschützend. 50–100 ml Direktsaft oder 500–1.000 mg Extrakt täglich – problemlos langfristig einsetzbar.
Herzglykosid-haltige Pflanzen (z. B. Maiglöckchenkraut, Meerzwiebel, Besenginster): Hochwirksam, aber mit extrem engem Dosierungsfenster. Hier gilt: nur ärztlich verordnen lassen, niemals selbst ansetzen – eine Überdosierung kann tödlich sein.
💡 Aus der Erfahrung: Die Kombination aus Weißdorn + Herzgespann + Melisse hat sich bei stressbedingtem Herzstolpern und leichten Rhythmusstörungen immer wieder bewährt. Sie stabilisiert den Puls, ohne ihn „abzuwürgen“, und beruhigt gleichzeitig das Nervensystem.
Homöopathie
Es gibt ganz verschiedene homöopathische Mittel, die bei Herzrhythmusstörungen infrage kommen, zum Beispiel: Coffea D6, Cactus D6, Convallaria majalis D6, Digitalis D6, Crataegus oxyacantha D6, Ignatia D6, Lycopus D6, Nux Vomica D6.
Bei überwiegend psychosomatisch bedingten Herzrhythmusstörungen konnte in einer Studie ein Kombinations-Präparat (Rytmopasc®) helfen. Die Inhaltsstoffe mit den Potenzierungen D2 und D3 sind: Apocynum cannabinum, Cheiranthus cheiri, Crataegus, Cytisus scoparius, Gelsemium sempervirens, Lilium lancifolium, Nitroglycerinum, Veratrum viride. Die erwähnte Anwendungsbeobachtung zeigte, dass das Präparat den Puls senken und die Häufigkeit von Extrasystolen der Herzkammern und der Herzvorhöfe reduzieren kann.
Sie sollten bei Herzrhythmusstörungen allerdings auf Selbstversuche verzichten. Solche ernsteren Beschweren gehören in die Hände eines erfahrenen Therapeuten.
Schüssler-Salze
Bei Herzrhythmusstörungen können folgende Schüssler-Salze hilfreich sein: Nr 2 – Calcium phosphoricum; Nr 5 – Kalium phosphoricum; Nr 7 – Magnesium phosphoricum und Nr 8 – Natrium chloratum (Natrium Muriaticum). Empfohlen werden Potenzierungen von D6 bis D12.
Um Ihre übrigen Behandlungswege zu unterstützen, nehmen Sie pro Schüssler-Salz vier bis sechs Tabletten pro Tag ein. Verteilen Sie die Gabe über den Tag und lassen Sie die Tabletten auf der Zunge zergehen.
Säure-Basen-Haushalt
Ein stabiler Säure-Basen-Haushalt kann für die Herzfunktion wichtig sein, da eine ausgeprägte Übersäuerung (Azidose) den Mineralstoffhaushalt stören und die Reizleitung am Herzen beeinflussen kann.
Aber: Eine tatsächlich manifeste Azidose ist bei gesunden Nieren selten und meist Folge schwerer Grunderkrankungen (z. B. Niereninsuffizienz, unkontrollierter Diabetes, schwere Lungenerkrankungen).
In der Naturheilkunde spricht man oft von einer „latenten Azidose“ – einem leichten Ungleichgewicht, das durch einen hohen Anteil säurebildender Lebensmittel, Bewegungsmangel oder chronischen Stress begünstigt wird. Ob dieser Zustand messbar ist, hängt von der Untersuchungsmethode ab (z. B. Blutgasanalytik vs. Urin-pH über 24 Stunden).
Empfehlung:
- Ernährung mit hohem Anteil an basenfördernden Lebensmitteln (Gemüse, Salate, Kräuter, Obst, Kartoffeln)
- Säurebildner (Fleisch, Wurst, Zucker, Weißmehlprodukte, Softdrinks) reduzieren
- Ausreichend Bewegung und Atemübungen, um Kohlendioxid effizient auszuscheiden
- Bei Herzrhythmusstörungen keine unkritische Einnahme von Basenpulvern – sie können bei falscher Dosierung Kalium- und Magnesiumwerte verschieben
Störfelder
Chronische Reizherde im Körper können den Herzrhythmus indirekt beeinflussen – vor allem über das vegetative Nervensystem. Dazu zählen Zahn- und Kieferstörfelder (z. B. tote Zähne, chronische Kieferostitis, NICO), Narben mit gestörter Nervenleitfähigkeit oder chronische Entzündungsherde im Nasennebenhöhlenbereich.
Auch bei Wetterwechsel-Beschwerden können vegetative Regulationsstörungen eine Rolle spielen.
Empfehlung:
- Zahnärztliche Kontrolle bei Verdacht auf Zahnherde oder Kieferentzündungen
- Untersuchung auffälliger Narben (z. B. Neuraltherapie-Testung)
- Chronische Nasennebenhöhlenprobleme naturheilkundlich behandeln (Inhalationen, pflanzliche Präparate, ggf. osteopathische Mitbehandlung)
Elektromagnetische Felder (EMF) können bei empfindlichen Personen den Herzrhythmus ebenfalls beeinflussen. Erste Hinweise aus Studien deuten darauf hin, dass hochfrequente Felder (Mobilfunk, WLAN) die Herzfrequenzvariabilität verändern können.
→ Im Alltag kann es sinnvoll sein, nächtlich WLAN auszuschalten, das Handy nicht am Körper zu tragen und kabelgebundene Verbindungen zu bevorzugen.
Wirbelsäule (Osteopathie, Chiropraktik, usw.)
Blockaden oder Fehlstellungen im Bereich der Brustwirbelsäule (insbesondere zwischen dem 3. und 5. Brustwirbel) können den Herzrhythmus über Nervenreflexe beeinflussen. Die dort verlaufenden sympathischen und parasympathischen Nervenbahnen steuern Teile der Herzaktivität.
Auch Verspannungen im oberen Rücken, im Hals-Nacken-Bereich oder im Zwerchfellbereich können vegetative Fehlsteuerungen auslösen, die Herzstolpern oder funktionelle Rhythmusstörungen verstärken.
Empfehlung:
- Osteopathische oder chiropraktische Untersuchung, um Blockaden, Fehlstellungen oder muskuläre Dysbalancen zu erkennen
- Sanfte Mobilisation und gezielte Lockerung der betroffenen Segmente
- ggf. ergänzend Dehn- und Atemübungen, um die Brustkorbbeweglichkeit zu verbessern und die vagale Regulation zu fördern
Gut zu wissen: In der Praxis berichten viele Patienten über eine spürbare Besserung ihrer Herzrhythmusstörungen nach Korrektur solcher Blockaden – besonders, wenn zusätzlich Stressreduktion und eine ausgewogene Mineralstoffversorgung (Magnesium, Kalium) umgesetzt werden.
Fazit
Wer seinem Herzen helfen will, sollte strukturiert vorgehen – aber nicht alles auf einmal umsetzen, sondern gezielt das angehen, was in der eigenen Situation wirklich relevant ist:
- Ursachen prüfen – Herz und Schilddrüse untersuchen lassen, Blutbild und Mineralstoffstatus aus dem Vollblut bestimmen (Kalium, Magnesium, Calcium, Eisen, Vitamin D).
- Medikamente checken – prüfen, ob aktuelle Präparate den Rhythmus beeinflussen könnten.
- Nährstoffe ausgleichen – gezielt ergänzen, was fehlt (Magnesium, Kalium, Omega-3, Coenzym Q10, L-Carnitin).
- Naturheilkundliche Maßnahmen beginnen – z. B. Weißdorn, Herzgespann, Melisse, Akupunktur, Entspannungsverfahren.
- Störfelder und Belastungen beseitigen – Zahnherde, chronische Entzündungen, Übersäuerung, Dauerstress.
- Lebensstil anpassen – ausreichend Schlaf, moderates Ausdauertraining, gesunde Ernährung, Reduktion von Koffein und Alkohol.
Nicht jeder braucht jeden Schritt – entscheidend ist, die eigenen Auslöser zu erkennen und dort anzusetzen, wo die größte Wirkung zu erwarten ist. So entsteht ein individueller Fahrplan, der Herz und Kreislauf nachhaltig entlastet.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter „Unabhängig. Natürlich. Klare Kante.“ dazu an:
Beitragsbild: fotolia.com
 Rene Gräber:
Rene Gräber:
Ihre Hilfe für die Naturheilkunde und eine menschliche Medizin! Dieser Blog ist vollkommen unabhängig, überparteilich und kostenfrei (keine Paywall). Ich (René Gräber) investiere allerdings viel Zeit, Geld und Arbeit, um ihnen Beiträge jenseits des "Medizin-Mainstreams" anbieten zu können. Ich freue mich daher über jede Unterstützung! Helfen Sie bitte mit! Setzen Sie zum Beispiel einen Link zu diesem Beitrag oder unterstützen Sie diese Arbeit mit Geld. Für mehr Informationen klicken Sie bitte HIER.


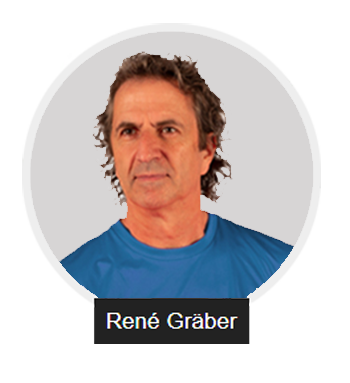 Rene Gräber:
Rene Gräber: