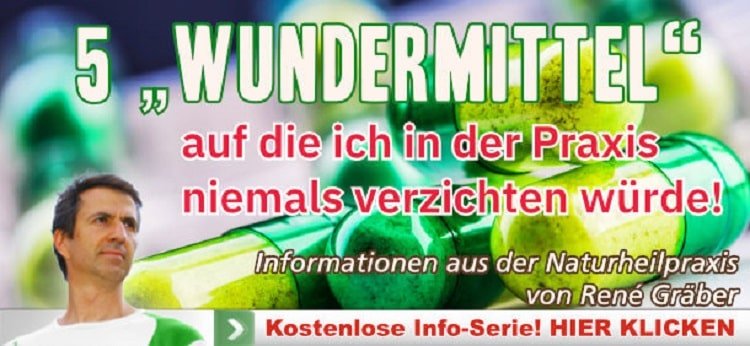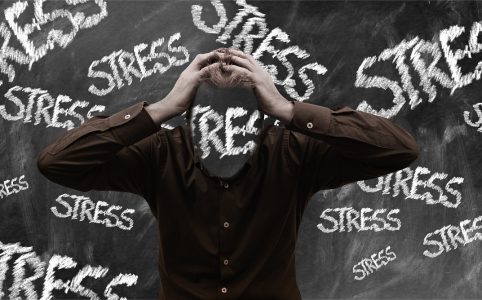In diesem Beitrag möchte ich Ihnen zeigen wie man eine Kehlkopfentzündung mit Hilfe von Naturheilkunde, bestimmten Vitalstoffen, Heilpflanzen und anderen Hausmitteln behandeln kann. Bleiben Sie dran, denn es wird interessant…
Was ist eine Kehlkopfentzündung?
Im Folgenden halte ich mich erst einmal daran, was die klassische Medizin dazu schreibt.
Laryngitis ist der Fachbegriff für eine Kehlkopfentzündung, genauer gesagt, für eine Entzündung im Bereich der Schleimhaut und des Skelettanteils. Je nach Verlauf unterscheidet man die akute (Laryngitis acuta) von der chronischen Form (Laryngitis chronica).
Die entzündlichen Prozesse sind hauptsächlich bakteriell oder viral verursacht, können als Symptom anderer Erkrankungen in Erscheinung treten und verursachen zum Teil schwere Hustenattacken, Heiserkeit oder auch Schmerzen.
Eine Laryngitis tritt vermehrt in den kalten Monaten (meist im Winter) auf. Insgesamt sind mehr Männer als Frauen betroffen. Während die akute Form in jeder Altersgruppe zu finden ist, entwickelt sich ein chronischer Verlauf hauptsächlich zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr.
Die Laryngitis acuta tritt häufig in Zusammenhang mit einer Erkältung in Erscheinung. Sie wird in 85 % bis 95 % aller Fälle durch Viren verursacht, kann aber auch durch Bakterien ausgelöst werden. Oft sind es dann Streptokokken, die die Schleimhäute des Kehlkopfes angreifen. Daneben kann eine Laryngitis auch bei einer übermäßigen stimmlichen Belastung in zu trockenen oder rauchigen Räumen (unter anderem bei Opernsängern, Lehrern) entstehen.
Die Symptomatik ist typisch, kann jedoch rasch mit anderen Erkrankungen verwechselt werden. Zum Beschwerdebild der akuten Form zählen eine raue Stimme, Heiserkeit bis hin zur Aphonie (Stimmverlust, Stimmlosigkeit), einem Trockenheitsgefühl in der Kehle, Kitzeln und Brennen im Hals, Hustenreiz, Schmerzen (bei stärkerer Ausprägung der Erkrankung) sowie Fieber. Die Stimmbänder sind gleichmäßig gerötet, frei beweglich und eventuell mit Fibrinablagerungen oder auch zähem Schleim bedeckt.
Die Laryngitis chronica entwickelt sich oftmals aus einer akuten Entzündung. Dies kann unter anderem der Fall sein, wenn die Stimmbänder nicht ausreichend geschont werden oder die Therapie der akuten Laryngitis nicht ausreichend war.
Begünstigend auf die Entstehung wirken unter anderem:
- ein Nikotin- oder Alkoholabusus,
- Arbeiten in staubreicher oder trockener Umgebung,
- mit viel Sprache oder Gesang einhergehende Tätigkeiten (zum Beispiel Nachrichtensprecher, Sänger),
- Stimmbandstörungen (unter anderem durch anatomische Anomalien),
- reizende Stoffe (Chemikalien),
- sowie chronische Entzündungen in anderen Körperregionen (zum Beispiel der Nasenschleimhaut oder Nebenhöhlen).
Die betroffenen Patienten klagen meist über eine langandauernde Heiserkeit, starken Husten, eine tiefere Stimme, ein Trockenheitsgefühl und Stimmstörungen.
In einigen Fällen fühlen Erkrankte einen Fremdkörper im Hals (Globusgefühl), hierbei handelt es sich jedoch in der Regel um eine Sinnestäuschung. Schmerzen sind eher selten. Die Stimmbänder sind deutlich gerötet, geschwollen und mit Schleim bedeckt. Die grobe Beweglichkeit der Bänder ist unverändert, die Feinabstimmung dahingegen ist eingeschränkt.
Die klassische Unterteilung erfolgt in akut und chronisch. Daneben finden sich weitere Erkrankungsformen, die ihre Bezeichnung zum Teil durch den Auslöser, zum Teil durch die Symptomatik erhalten.
Die Laryngitis diphtherica entsteht im Rahmen einer Diphtherie (auch „echter Krupp“). Die Diphtherie ist eine akute, zum Teil lebensbedrohliche, durch Bakterien verursachte Infektionskrankheit, welche sich durch eine ausgeprägte Symptomatik vor allem im Hals-Rachen-Bereich auszeichnet.
Die Laryngitis subglottica entsteht bei Kleinkindern in Verbindung mit einer akuten Kehlkopfentzündung. Die Entzündung tritt unmittelbar unter den Stimmbändern auf und geht einher mit einem bellenden Husten, Atemnot, inspiratorischem Stridor (Pfeifgeräusche während des Einatmens) und Fiber. Die Medizin kennzeichnet diese Entzündungsform auch mit dem Begriff Pseudokrupp.
Die Epiglottitis (Epiglottisödem, Laryngitis supraglottica) zeigt sich ebenfalls nahezu ausschließlich bei Kleinkindern (vor allem zwischen dem zweiten und sechsten Lebensjahr). Die Ursachen sind mannigfaltig (unter anderem Infektion mit Haemophilus influenzae, Zungengrundangina, Allergie, infizierte Tumoren). Es kommt zu einer eitrigen Entzündung mit starker Heiserkeit, Schluckbeschwerden, inspiratorischem Stridor, verwaschener Sprache sowie Fieber. Diese Form führt unbehandelt zu einem raschen Tod (meist innerhalb von 48 Stunden).
Die Laryngitis chronica sicca ist eine trockene Entzündung des Kehlkopfes mit Abbau der ummantelnden Schleimhaut, zähem Schleim und gelblich-brauner Krustenbildung. Diese Form findet sich vermehrt bei Menschen mit schlechter Konstitution oder Arbeitnehmern, die fortwährend einer großen Hitze ausgesetzt sind (zum Beispiel Hochofenarbeiter).
Bei der Laryngitis chronica hyperplastica kommt es zu einer Wucherung der Bindegewebsstrukturen. Die Stimmbänder weisen polypös-ödematöse Lappen auf (Reinke-Ödem), die in der Glottis (stimmbildender Apparat, der sich aus den Stimmbändern, dem Stellknorpel und der zwischengelagerten Stimmritze zusammensetzt) flattern können.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter „Unabhängig. Natürlich. Klare Kante.“ dazu an:
Auslöser und weitere mögliche Ursachen
Neben den typischen Ursachen für eine Laryngitis lassen sich noch viele weitere auslösende bzw. begünstigende Faktoren benennen.
Hierzu zählen unter anderem:
- die Fehl- und Mangelernährung, sowie
- andauernder Stress (wirken beide schwächend auf das Immunsystem),
- allergische Reaktionen,
- eine Immunschwäche (zum Beispiel HIV),
- gastroösophageale Erkrankungen (zum Beispiel Refluxkrankheit, Ösophagitis),
- Infektionen der oberen Luftwege (zum Beispiel Grippe, Tonsillitis, Lungenentzündung), sowie
- die Tuberkulose.
Die akute und chronische Laryngitis können sich deutlich auf den Allgemeinzustand auswirken, auch wenn dies bei der akuten Form in der Regel nur von kurzer Dauer ist.
Jede Kehlkopfentzündung, die zu starken Beeinträchtigungen führt, sollte immer ärztlich abgeklärt werden. Vor allem dann, wenn es zu Beschwerden kommt, die die Atmung beeinflussen oder auch wenn es zu zähflüssigem bis hin zu blutigem Auswurf kommt.
Die durch Mediziner gewählte Therapie dient dabei der Linderung und ggf. Beseitigung der Symptome. Sie dient daneben u.a. auch dem Ausschluss einer möglichen Entartung (Kehlkopfkrebs).
Diagnose und Untersuchungsmethoden
Zu den Untersuchungsmethoden gehört immer die Anamnese, bei der sowohl Erkrankungen der Familie als auch die Erkrankungen und Beschwerden der betroffenen Person aufgezeichnet werden.
Es folgen die Inspektion und körperliche Untersuchung. Hierbei wird u.a. der Rachenraum auf etwaige Veränderungen hin untersucht.
Mittels Laryngoskopie kann der Kehlkopfbereich betrachtet werden. Sowohl ein Rachenabstrich als auch der Auswurf (zum Beispiel Schleim) können Hinweise auf den Erreger liefern. Das Blutbild wird auf Entzündungsparameter (zum Beispiel CRP) hin kontrolliert.
Der Diagnosefindung sowie auch dem Ausschluss anderer Erkrankungen dienen zusätzlich bildgebende Verfahren. Hierzu zählen die Laryngostroboskopie (Beurteilung der Stimmlippenfunktion), die CT (Computertomographie), die MRT (Magnetresonanztomographie) sowie die Röntgenaufnahme.
In begründeten Fällen kann auch eine Gewebeprobe (Biopsie) entnommen werden.
Was kann es noch sein? Eine Differentialdiagnose
Differentialdiagnostisch auszuschließen sind u.a.:
- die Fremdkörperaspiration (Einatmen von Fremdkörpern, die die Atemwege verlegen),
- das Larynxkarzinom (Kehlkopfkrebs),
- das Larynxpapillom (gutartiger Tumor),
- die Diphtherie,
- die Tuberkulose,
- die spastische Bronchitis,
- Stimmlippenknötchen,
- die Reflux-Ösophagitis,
- ein entzündlicher Prolaps des Sinus Morgagni (ödematös geschwollene Schleimhaut zwischen Stimmbändern und Taschenfalte), sowie
- Polypen oder Zysten im Bereich der Stimmbänder.
Behandlung mit Schulmedizin
Zur Behandlung der akuten Laryngitis können Analgetika (Schmerzmittel) und Mukolytika (schleimlösende Medikamente) verordnet werden.
In Ausnahmefällen kommen auch Antibiotika (bei Bakterienbefall) zum Einsatz.
Alle verordneten Präparate dienen der Linderung der Symptomatik. Die akute Laryngitis bedarf meistens keiner weiterführenden Therapie, da sie eigenständig nach kurzer Zeit (ca. zehn Tage) ausheilt.
Die chronische Laryngitis dagegen gilt in der Schulmedizin als nicht heilbar. Ich halte diese Aussage für mehr als fahrlässig! Denn ich konnte in der Praxis einige Fälle beobachten, die ich als geheilt bezeichnen würde. Und das waren alles Fälle, die schon bei mehreren „Spezialisten“ waren, inklusive Uni-Kliniken.
Naturheilkunde und Alternative Medizin
Der Linderung einer akuten Laryngitis dienen viele altbewährte Hausmittel. Vor allem bei einer viral bedingten Entzündung ist die spezifische Behandlung kaum möglich.
In der akuten Phase der Erkrankung sollte jegliche mechanische Belastung der Stimmbänder vermieden werden (Schonung durch wenig Reden).
Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr unterstützt die Befeuchtung der Schleimhäute. Zusätzlich wird der Schleim flüssiger, wodurch er sich besser abhusten lässt.
Die Meidung von Nikotin, Alkohol, Kaffee und scharfen Gewürzen (alles Reizmittel) in dieser Zeit ist unerlässlich.
Auch sollte auf eine geregelte Raumtemperatur geachtet werden. Diese sollte weder zu warm noch zu kalt sein und eine gemittelte Luftfeuchtigkeit besitzen.
Der Aufenthalt in staubreichen Regionen ist zu meiden.
Die Inhalationstherapie mit Salzlösungen, Kamillen- oder Salbeitee unterstützt die Befeuchtung der Atemwege. Warme Halswickel lindern ebenfalls die Beschwerden.
Anorganische Naturheilmittel
Wasserstoffperoxid (H2O2) ist eine starkes Oxidationsmittel und als solches antibiotisch. Bei Entzündungen der oberen Atemwege erfolgt die Anwendung mit einer Ohrspülung. Ein Fingerhut mit dreiprozentigem H2O2 wird bei niedergelegtem Kopf nacheinander in jedes Ohr geträufelt. Die Freisetzung von Sauerstoff macht sich durch Kribbeln und leichtes Stechen bemerkbar und die Blasenbildung ist hörbar. Der Vorgang dauert etwa 10 Minuten. Danach lässt man die Flüssigkeit gut nach außen abtropfen.
Kolloidales Silber bekämpft Bakterien in fast dem gleichen Maße wie viele Antibiotika, wie Studien beweisen. Ich rate meistens zu einer Gurgellösung.
Alternativ können Sie auch mit schlichter Salzlösung gurgeln. Himalaya-Salz ist zu empfehlen, kein Meersalz. Eine Lösung mit Himalaya-Salz kann auch zur Spülung der Nasennebenhöhlen verwendet werden. Dazu nehmen Sie eine Nasendusche (Apotheke) oder einen Neti-Pot aus der traditionellen chinesischen Medizin. Mit dem kleinen, einem Teekännchen ähnlichen Behältnis, können Sie die Salz-Lösung ins Nasenloch verbringen und in die Nasennebenhöhlen laufen lassen. Neigen Sie dazu den Kopf nach vorne, um die Hohlräume bestmöglich zu erreichen. Danach spucken Sie die Lösung aus und schnauben Sie die Reste aus der Nase heraus.
Verwenden Sie destilliertes, sterilisiertes und filtriertes Wasser mit einem Teelöffel Himalaya-Salz auf zwei Tassen Wasser. Die Lösung soll bei der Anwendung lauwarm sein.
Achten Sie auf eine ausreichende Versorgung mit Zink. Bei akut einsetzenden Symptomen sollte sofort mit einer Supplementierung mit 50 mg pro Tag begonnen werden.
Naturheilkunde, Alternativmedizin & Hausmittel
Aromatherapie
Orale Einnahmen von Aroma-Essenzen sollten von erfahrenen Therapeuten begleitet werden. Cajeput, Myrthenheide, Salbei und Zwiebel.
Ernährung
Sie können die Ernährungsratschläge befolgen die für alle Entzündungen gelten.
Beachten Sie bitte besonders die Schädlichkeit von Zucker für das Immunsystem.
Fermentierte Lebensmittel fördern ein gesunde Darmflora und unterstützen damit auch das Immunsystem. Probiotika wie Bactoflor können den Aufbau eines gesunden Mikrobioms unterstützen.
Zu empfehlen ist auch ein Speiseplan mit vitaminreichen Lebensmitteln. Vitamin C, aber auch Vitamin E und Folsäure sind für ein gut funktionierendes Immunsystem besonders wichtig. Essen Sie daher viel Paprika, Süßkartoffeln, Brokkoli, Rosenkohl, Papaya, Zitrusfrüchte, Spinat, Mangold, Grünkohl, und Tomaten. Kiwis wirken durch ihren Gehalt an Polyphenolen und Carotinoiden besonders stark entzündungshemmend. Gewürze können die Schleimlösung unterstützen, weil sie die die Sekret-Bildung fördern (Speichel) und so die Beläge verdünnen und dadurch beseitigen helfen. Bekannt ist diese Wirkung vom Piperin des schwarzen Pfeffers. Nutzen Sie auch die antibiotischen Eigenschaften des Knoblauchs.
Kokosöl enthält Laurinsäure, deren Umwandlungs-Produkte Viren und gramnegative Bakterien zerstören können.
Omega-3-Fettsäuren sind ebenfalls gute Entzündungshemmer. Verzehren Sie daher reichlich Krillöl und Meeresfrüchte. Auch im Bio-Rindfleisch sind die Fettsäuren in hohen Mengen enthalten, daneben auch das Spurenelement Zink, das die Körperabwehr stärkt.
Hühnersuppe ist ein altes Hausmittel gegen Entzündungen der oberen Atemwege. Die Brühe enthält das immunstabilisierende Carnosin und die schleimlösende Aminosäure Cystein.
Kräftigend für das Immunsystem sind auch rohe Eier, achten Sie aber auf die Herkunft aus biologischem Anbau. Dies ist auch bei der Wahl der übrigen Lebensmittel zu empfehlen.
Honig enthält Verbindungen mit antiviralen und antibiotischen Eigenschaften und sollte täglich verzehrt werden.
Folgendes Rezept ist überliefert:
1 Ingwer-Wurzel wird fein gerieben wird in 0,5 Liter Liter Wasser mit 2 Esslöffel Honig gekocht, bis eine sehr sämige Flüssigkeit entsteht. Danach alles durch ein grobes Küchensieb laufen lassen. Den Sirup in ein sauberes Glas abfüllen und mehrmals täglich einen Teelöffel einnehmen und im Mund zergehen lassen.
Ein anderes Rezept geht von rohen Zutaten aus, die in einem Mixer zu Brei verarbeitet werden. Die Mischung enthält jeweils eine Handvoll Knoblauch, Zwiebeln, Ingwer, Meerrettich und ein halbes Handvoll Habanero-Pfeffer (Chilisorte). Ein Schuss Bio-Apfelessig sorgt nicht nur für Feuchtigkeit, sondern ist Teil der wirksamen Bestandteile (Apfelessig kann auch in reiner Form angewendet werden). Den Brei können Sie frisch verzehren oder nach zwei Wochen als Tinktur anwenden.
Eine gute Wirkung erzielt auch ein Schnupf-Pulver aus jeweils 7 Teilen Gelbwurzel (Kurkuma) und Bayberry-Rinde sowie aus jeweils einem Teil Cayennepfeffer und getrocknetem Knoblauch.
Ätherische Öle wirken entzündungshemmend. Zu empfehlen sind hier Oregano-Öl mit seinem hohen Gehalt an Carvacrol. Ratsam sind daneben Eukalyptus, Pfefferminze und Fenchel sowie das Destillat aus der amerikanischen Ulme. Anzuwenden sind die Öle als Tees oder Inhalationen mit dem Diffusor. Die Extrakte können tropfenweise mit einem Glas Wasser eingenommen werden.
Heilpflanzen
Echinacea (Sonnenhut) wirkt Studien zufolge ebenso gut wie Chlorhexidin und Lidocain-Sprays. Daneben ist eine Gurgellösung aus Süßholzwurzeln hilfreich.
Holunder enthält viel Vitamin C und Flavonoide sowie das Anthocyan Quercetin. Die Beeren können Sie als Sirup einnehmen und die Blüten als fertiges Tonikum oder Tee. Sinnvoll ist eine Kombination mit Schafgarbe, Pfefferminze, Ingwer und Lindenblüten.
Curcumin aus dem Kurkuma (Gelbwurz) eignet sich ebenfalls als natürliches Mittel zur Bekämpfung von Entzündungen.
Medizinische Pilze (Heilpilze) haben ebenfalls eine antivirale und antibakterielle Wirkung. Nutzen Sie bei Laryngitis Shiitake, Reishi und der Coriolus.
Propolis gehört im weiteren Sinne zu den phytomedizinischen Präparaten. Wirksam sind in dem Bienenharz das Flavon Apigenin sowie die Kaffeesäure.
Säure-Basen-Haushalt
Der Säure-Basen-Haushalt und das Thema „Übersäuerung“ kann bei vielen akuten und
chronischen Beschwerden eine Rolle spielen.
Schüssler Salze
Infrage können folgende Schüssler Salze kommen:
Ferrum phosphoricum Nr. 3
Kalium sulfuricum Nr. 6
Natrium phos. Nr. 9
Silicea Nr. 11
Sonstiges
Stellen Sie das Rauchen ein. Wer bei einer Kehlkopfentzündung immer noch raucht – dem ist nicht zu helfen.
Beitragsbild: 123rf.com – subbotina
Dieser Beitrag wurde letztmalig am 18.9.2019 aktualisiert.