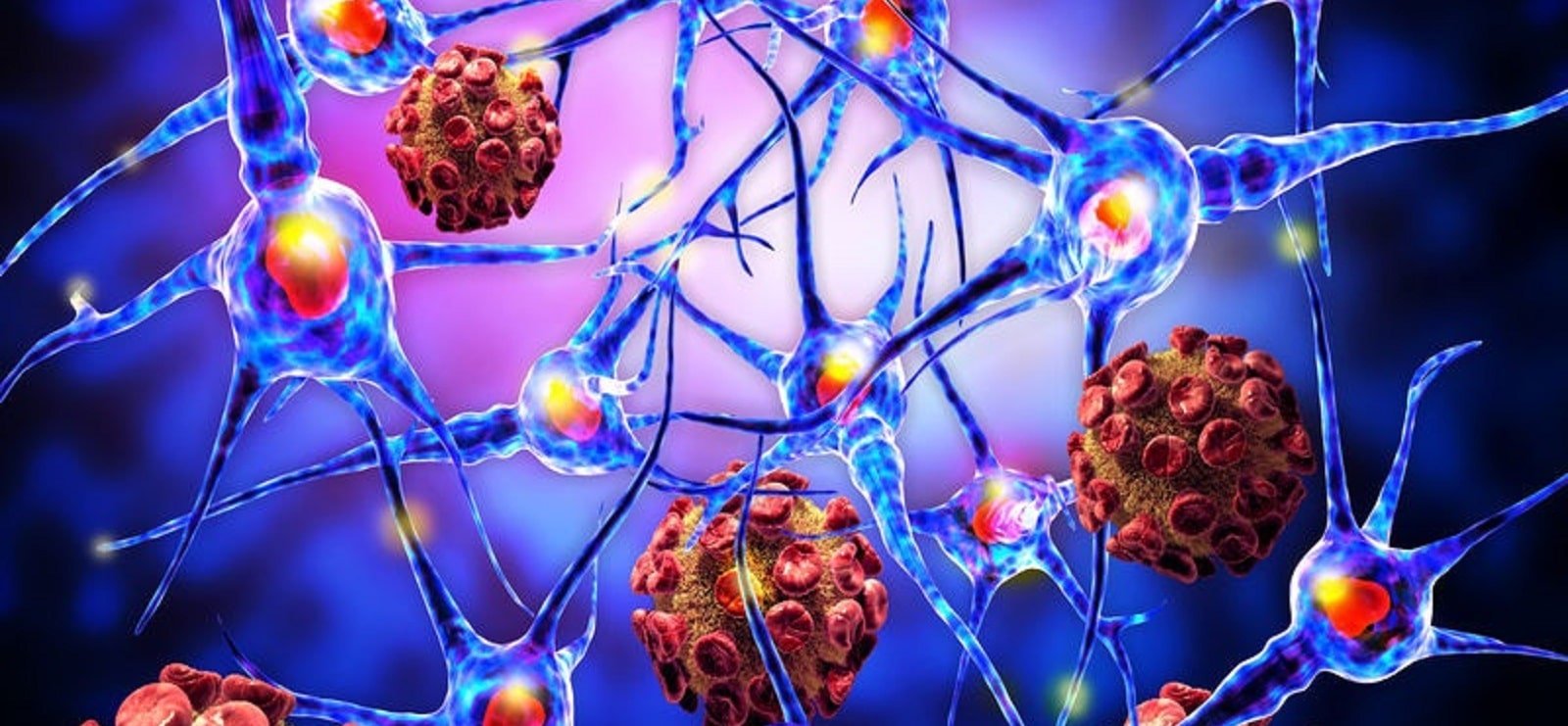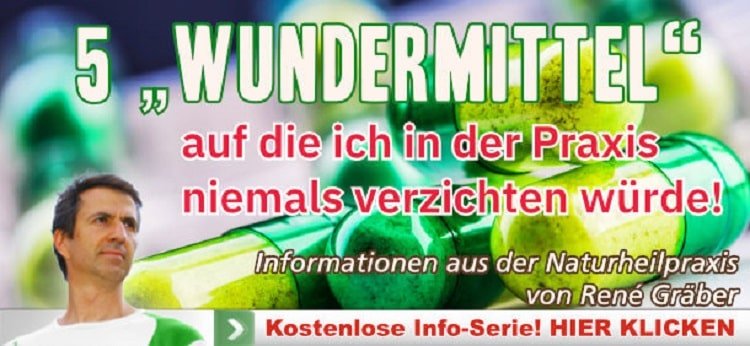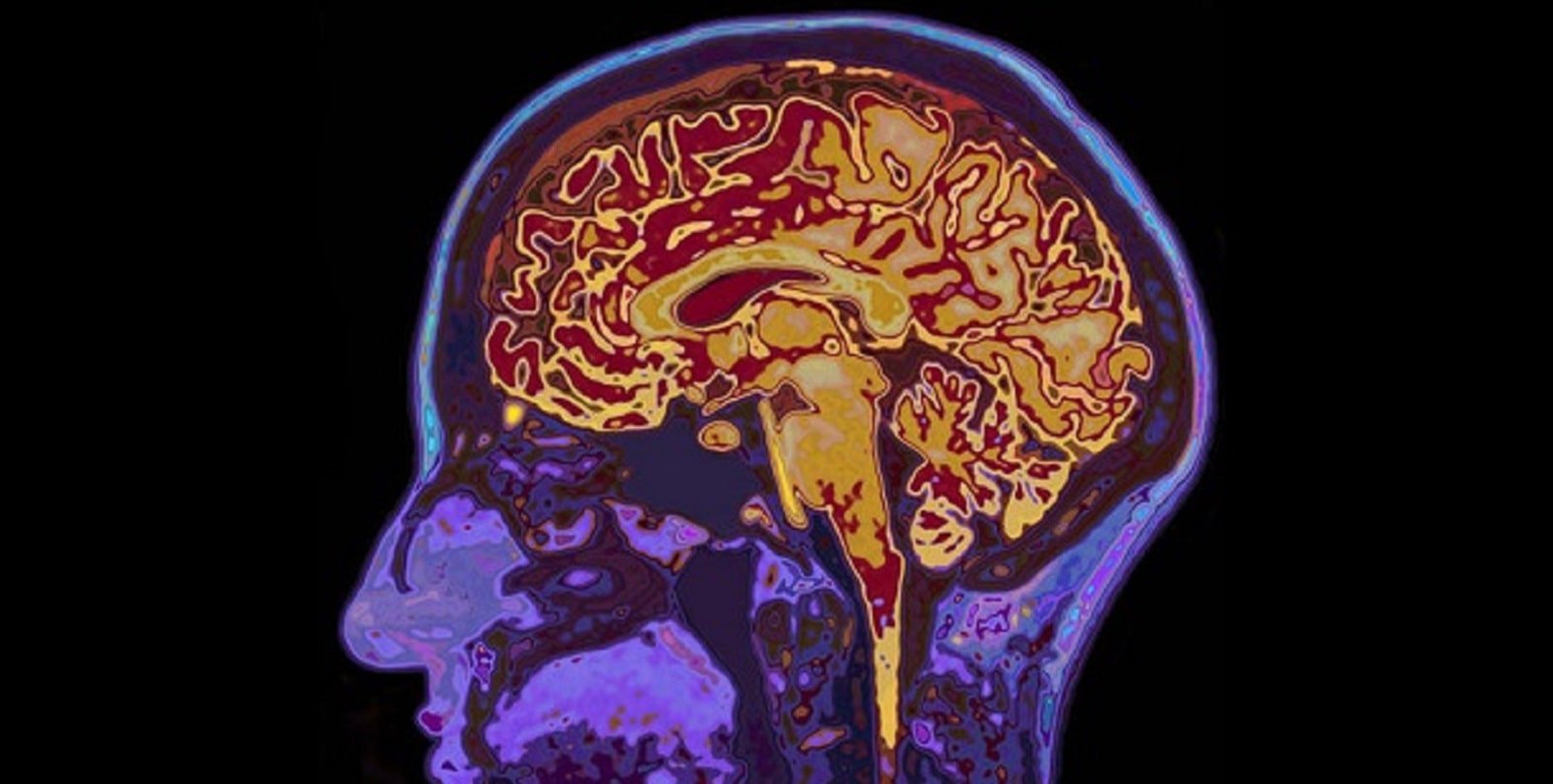Borreliose – Die naturheilkundliche und alternative Therapie
600 00 Neuinfektionen pro Jahr – und dennoch bleibt jede fünfte Betroffene trotz doppelter Antibiotikakur krank. Wie kann das sein, wenn die Medizin behauptet, „alles unter Kontrolle“ zu haben? Seit 1998 begleite ich Menschen, die nach Zeckenstich, Wanderröte – und vermeintlicher Entwarnung – in das Niemandsland chronischer Beschwerden abrutschen: wandernde Gelenkschmerzen, Nebel im Kopf, Nerven, die brennen wie blanke Drähte. Spirochäten, die sich in Biofilmen verschanzen, lachen über Doxycyclin & Co.
Doch es gibt Türen, die Schulmedizin selten öffnet: der ganze Beifuß statt isoliertem Artemisinin, Ozon statt Dauerantibiotika, Hyperthermie statt Resignation, Stevia-Extrakt gegen Biofilme, Methylenblau für die Energiekraftwerke der Zelle, Cannabis zur Entzündungsbremse. In diesem Beitrag zeige ich, warum gerade diese Verfahren dort greifen, wo Standardtherapien scheitern – und wie Sie sie verantwortungsvoll einsetzen. Wenn Sie bereit sind, die gängigen Dogmen zu hinterfragen, finden Sie hier keine Heilsversprechen, sondern handfeste Strategien, die sich in der Praxis bewährt haben.
Fakten zur Borreliose
Die Borreliose gilt als eine Infektionskrankheit, die meistens durch einen Zeckenstich (manche sagen auch Zeckenbiss) auf den Menschen übertragen wird. Die nach dem Arzt Amédée Borrel benannten Borrelia-Bakterien gehören zu den Spirochaeten, zu denen auch der Erreger der Syphilis zählt.
Mittlerweile soll es auch Insekten geben, etwa Stechmücken oder Pferdebremsen, die die Krankheit übertragen können. Allerdings können die Borrelien im Darm der Kerbtiere nicht lange überleben. Nur an das Darm-Milieu der Spinnentiere sind die Bakterien optimal angepasst.
Die Erreger gelangen aus dem Darm der Tiere in deren Speichel, der beim Stich (nicht Biss) in die Blutgefäße der Haut übergeht. Der Befall der Spinnentiere mit den Erregern schwankt regional und wird auf zwischen 2 % und 50 % beziffert. Wenn die Zecke Borrelien in sich trägt, kommt es bei jedem vierten Stich zur Übertragung.
Kurz nach der Infektion (1. Stadium: lokal) leiden die Patienten nur unter geringen Beschwerden, weswegen die Erkrankung oft verkannt wird. Doch ausgerechnet in dieser Situation wäre eine Therapie mit Antibiotika über anderthalb Monate möglich.
Das 2. Stadium ist die systemische Phase der Infektion. Nun breiten sich die Erreger im ganzen Körper aus und befallen mehrere Organe wie das periphere und zentrale Nerven-System, Herz, Blutgefäße und Gelenke. Gleichzeitig beginnen die Bakterien mit der Bildung latenter Formen. Diese Zellen weisen nicht die langgestreckte, “wurmförmige“ Gestalt auf, sondern sind kugelig geformt. Bezeichnet werden diese Zellen als Blebs, Round Bodies und Biofilme.
Die Zellwände dieser “Schläfer“ sind reduziert oder fehlen ganz. Solche persistierenden Borrelien verstecken sich größtenteils sogar in den Körperzellen und entziehen sich dadurch der Antibiotika-Behandlung und dem effektiven Zugriff des Immunsystems. Auf einen noch unbekannten Reiz hin verwandeln sich die Blebs in die aktive Form und setzen ihr unheilvolles Geschehen fort. Auf diese Weise entstehen über Jahre hinweg immer wieder neue Krankheitsschübe.
Diese Phase der chronischen Rezidive wird gelegentlich auch als 3. Stadium bezeichnet.
Nicht jede Übertragung verursacht die Krankheit
Jährlich infizieren sich ca. 60.000 Menschen in Deutschland mit den Borreliabakterien. Während viele Tiere immun gegen diese Borrelien zu sein scheinen, kann die Infektionskrankheit unter anderem Menschen, Hunde und Pferde befallen. Die Erkrankungsfälle nehmen durch den Klimawandel bedingt tendenziell zu.
Allerdings bedeutet nicht jeder Zeckenstich mit einer Übertragung automatisch eine effektive Infektion. In Deutschland beträgt die Wahrscheinlichkeit, nach einem Biss auch infiziert worden zu sein, zwischen 1,5 und 6 Prozent.
Eine manifeste Erkrankung tritt bei 0,3 bis 1,4 Prozent auf (siehe: Lyme-Borreliose – RKI-Ratgeber für Ärzte). Bislang sind 37 Arten von Borrelien bekannt.

Bildquelle: fotolia.com – c Bobo
Erreger erst spät entdeckt
Der Arzt Alfred Buchwald hatte 1883 ein Krankheitsbild mit ähnlichen Symptomen wie bei Borreliose dokumentiert. Heute ist klar, dass der Ausbruch der Krankheit im Jahr 1975 in Lyme/Connecticut auf Erreger zurückgeht, die erst 1982 beschrieben wurden.
Der Bakteriologe Wilhelm Burgdorfer veröffentlichte seine Forschungen über eine arthritisähnlichen Erkrankung. Nach ihm benannt ist der Erreger Borrelia burgdorferi.
Ist die Borreliose vom Militär gezüchtet?
EXKURS: Bevor wir aber zu den Symptomen und Therapien kommen, eine Anmerkung zur möglichen Entstehung der Borreliose. Folgendes wird angenommen: Die Borreliose wurde als biologische Waffe während des Zweiten Weltkriegs von den Deutschen eingesetzt und in den Kriegsgebieten verbreitet. Waren die Bakterien zuvor recht harmlos, so wurden sie im Labor gezielt verändert, sodass sie zu gefährlichen Krankheitserregern wurde. Die Zecken haben sich als Kriegswaffe aber nicht bewährt, da die Erkrankung zu langsam voranschreitet.
Die Theorie besagt weiter, dass der deutsche Veterinärmediziner Erich Traub, der bereits unter der Herrschaft der Nationalsozialisten die Borrelienversuche unternahm, diese später in das amerikanische Militärlabor Plum Island Animal Disease Center (PIADC) bei New York mitbrachte. Die 1954 gegründete Einrichtung ist offiziell für die Verteidigung gegen Angriffe mit biologischen Waffen zuständig. Im Zuge der Experimente sollen allerdings Borrelien infolge technischer Störungen in die Umwelt gelangt sein. Schließlich sollen infizierte Zecken dann mit Vögeln, Rehen oder möglicherweise Hurrikans an die Ostküste der USA gelangt sein und haben sich von dort aus immer weiter ausgebreitet. Für diese Theorie spricht unter anderem, dass es sich in den USA lediglich um einen Borrelienstamm handelt, während in Europa viele Formen vorkommen.
Weitere Hinweise für geheime Forschungen auf Plum Island
Verdächtig ist auch das Auftreten anderer Endemien in der Nähe von Plum Island. So wütete in der Region 1960 die Entenpest, bis 1999 dort das Nil-Fieber ausbrach und eine weitere (nicht zu benennende) Endemie die Hummer dezimierte. In den 1970er Jahren kam es dreimal zu Ausbrüchen der Maul-und-Klauen-Seuche. Auch der Naziwissenschaftler Traub soll an dieser Infektion geforscht haben. Er wollte sie wahrscheinlich zur biologischen Waffe umfunktionieren, um die Sowjetunion in die Knie zu zwingen.
Die US-Regierung hat gelogen
Vertreter des PIADC hatten stets bestritten, Borrelien-Versuche unternommen zu haben. Die US-Regierung dementierte immer wieder pauschal, dass auf Plum Island biologische Waffen entwickelt würden. Doch das stellte sich als Lüge heraus, wie die New York Times 1998 berichtete. Nach Darstellung des renommierten Blattes hatten die Forschungen des PIADC genau dasselbe Ziel wie die Nazis: den Angriff der Sowjetunion mit biologischen Waffen (Closely Guarded Secrets: Some Island You Can’t get to Visit, NYT, 17.03.1998). Prompt relativierte die US-Regierung ihre Darstellung: bereits Nixon habe 1969 derartige Bestrebungen unterbunden.
Diese Zusammenhänge werden im Buch: Lab 257: The Disturbing Story of the Government’s Secret Plum Island Germ Laboratory, von Michael C. Carroll beschrieben. Diese Information zur Quelle erhielt ich von einem Vereinsmitglied des Borreliose Informations- und Selbsthilfevereins München e.V. Siehe auch: Wikipedia, Erich Traub (en.wikipedia.org/wiki/Erich_Traub)
Wie Erich Traub über die Operation Paper Clip nach dem Zweiten Weltkrieg von der US-Regierung zum Zwecke der Kriegsforschung rekrutiert wurde, dokumentieren Glen Yeadon und John Hawkins in ihrem Buch: The Nazi Hydra in America: Suppressed History of a Century, 31.10. 2008
So, nun weiter zur Borreliose…
Bevor wir aber zu den Symptomen und der Therapie kommen, möchte ich noch die neuesten „Entwicklungen“ erwähnen:
Die „Anaplasma Borreliose“
Seit Neuestem gibt es ein weiteres Bakterium, das eine Lyme-Borreliose auszulösen scheint. Allerdings handelt es sich bei diesem Bakterium nicht um eine neue Art aus der Gattung der Borrelien, sondern aus der Gattung der Anaplasma. Auch diese Art der Bakterien ist infektiös und wird ebenfalls über Zeckenbisse übertragen. Hunde, Katzen, Pferde und Kühe können auch infiziert werden.
Im Jahr 2014 wurde die neue Art von Anaplasma im Nordosten von China gefunden. Ihr Zwischenwirt ist eine Zecke, die primär auf Ziegen vorzukommen scheint. Die Arbeit dazu wurde im „Lancet“ veröffentlicht: Human infection with a novel tick-borne Anaplasma species in China: a surveillance study.
In dieser Arbeit sammelten die Autoren Blutproben von Probanden, die in den vorausgegangenen 2 Monaten einen Zeckenbiss gehabt hatten. Das Blut wurde auf Anaplasma Arten untersucht und positive Befunde kultiviert. Die gefundenen Bakterien wurden morphologisch und genetisch analysiert, um zu einer genauen Bestimmung zu gelangen. Weiter wurden Antikörper im Serum ermittelt.
Resultat: Bei 28 von 477 Probanden (= 6 Prozent) wurde eine Infektion durch Anaplasma festgestellt. Eine genauere genetische Analyse der beobachteten Bakterien ergab, dass sie sich genetisch von anderen, bislang bekannten Formen von Anaplasma deutlich unterschieden.
Bei 22 Patienten zeigte sich eine vierfache Erhöhung des Antikörper-Titers. Alle betroffenen 28 Patienten entwickelten Fieberzustände, 23 Patienten manifestes Fieber, 14 Kopfschmerzen, 13 Malaise, 9 Schwindel, 4 Muskelschmerzen und 4 Schüttelfrost. Zusätzlich zeigten 10 der 28 Betroffenen Hautausschläge oder -schorf, 8 eine Lymphknotenschwellung, 8 hatten gastrointestinale Beschwerden und 3 einen steifen Nacken.
5 Patienten mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden aufgrund schwerer gesundheitlicher Einschränkungen. Bei 6 von 17 Patienten, für die Laborwerte vorlagen, zeigte sich eine Erhöhung der Leber-Aminotransferase.
Schlussfolgerung: Das Auftauchen von Anaplasma capra als Verursacher einer Infektion beim Menschen gibt allen Grund, entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, wie sie auch gegen Zeckenbisse ergriffen werden, um eine Borreliose zu verhindern.
Meine Einschätzung dazu
Wenn man die Zahlen vergleicht, dann sieht es mit dem neuen Erreger nicht besonders gut aus. Während laut RKI, ein Biss in 1,5 bis 6 Prozent der Fälle zu einer Borreliose-Infektion führt, sind es bei Anaplasma capra ebenfalls 6 Prozent. Aber die Borreliose-Infektionen wird „nur“ in 0,3 bis 1,4 Prozent der Fälle manifest. Bei Anaplasma capra waren es 100 Prozent der Betroffenen, bei denen die Infektion manifest wurde und die mehr oder weniger stark ausgeprägtes Fieber entwickelten und zudem andere unterschiedliche Symptome.
Und damit wären wir bei dem Gebiet der:
Symptome einer Borreliose
Wenn Borrelien beim Zeckenbiss übertragen worden sind, erscheint nach 5 bis 30 Tagen die typische Wanderröte (Erythema chronicum migrans) um die Einstichstelle herum. Dabei ist die Haut ringförmig oder flächig-rund gerötet. Allerdings tritt dieses typische Symptom nur in 40 % der Fälle in Erscheinung.
Der rote Bereich vergrößert sich zunächst und kann Beschwerden wie Brennen oder Jucken hervorrufen. Die Wanderröte ist jedoch ein nicht bei jeder Infektion ausgeprägtes Zeichen und außerdem sehr variabel.
Auf keinen Fall sollte jede kleine Rötung an der Stichstelle für ein Zeichen der Infektion angesehen werden. Oft ist dies nur eine normale Hautreaktion auf den mechanischen Reiz hin. Nur wenn sich nach 2 Tagen eine deutliche Vergrößerung des Bereichs zeigt und sich weiterentwickelt, handelt es sich um eine echte Wanderröte.
Der Arzt kann die Fläche der Rötung beim ersten Auftreten messen oder auch mit einer Digitalkamera fotografieren, um einen späteren Vergleich vornehmen zu können. Ein Test auf Antikörper ist in diesem Stadium nicht erforderlich, weil noch gar keine Immunglobuline vorliegen können. Oder es sind Antikörper nachweisbar, die von einer früheren Infektion stammen.
Das chronische Stadium kann mit Herzbeschwerden (Borrelia-Karditis), Entzündungen der Blutgefäße (Borrelia-Vaskulitits) und Gelenke, Neuropathien (Neuro-Borreliose) sowie psychischen Erkrankungen einhergehen. Typisch für diese Krankheits-Phase sind auch Hautveränderungen vor allem an Beinen und den Händen. Die Haut schwillt durch Wassereinlagerungen an und verfärbt sich dunkel-violett (Herxheimer-Krankheit).
Über die verschiedenen Stadien und deren Einteilung schreibe ich etwas mehr im Beitrag: Borreliose – die Symptome und Stadien.
Falsch positive Tests möglich
Unwahrscheinlich ist das nicht, weil dies bei vielen Menschen der Fall ist, wie Untersuchungen gezeigt haben. Deswegen ist auch eine Erfolgs-Kontrolle mit dem Test nach der Therapie überflüssig.
Ein positives Ergebnis sagt nichts über das akute Krankheitsgeschehen aus. Das betrifft auch den Nachweis der Immunglobuline M (IgM).
Diese schnell gebildeten Antikörper erscheinen als erste im Blut und sind bei Borreliose noch sehr lange vorhanden, ohne dass noch Erreger im Körper sind. Die Gründe dafür sind noch unbekannt.
Die Symptome sind darüber hinaus sehr vielfältig und werden oft im Anfangsstadium nicht mit Borreliose in Verbindung gebracht. Die Infektion kann sich je nach Stadium mit:
- Fieber,
- Kopfschmerzen und Muskelschmerzen,
- Gelenkentzündungen,
- Lupus erythrmatodes,
- Nervenschmerzen,
- Lähmungen und Gefühlsstörungen,
- sowie in seltenen Fällen mit einer Herzbeutelentzündung bemerkbar machen.
Beschrieben wurden auch psychiatrische Symptome wie Angststörungen, Depressionen und Erschöpfungszustände.
Daneben können auch Beeinträchtigungen der Schilddrüse auftreten.
Die Lähmungserscheinungen mit Nervenschmerzen treten im Zusammenhang mit der Neuro-Borreliose auf. Dabei kommt es oft auch zu einer Infektion des Zentral-Nerven-Systems. Manche Forscher vermuten, dass dieses Krankheitsbild mit der Multiplen Sklerose identisch sei. Dies habe ich dargestellt in meinem Beitrag: Multiple Sklerose und Borreliose: Werden hier Krankheiten verwechselt?
Nachweis / Diagnose
Die vielfältigen und teils generalisierten Symptome erschweren die Diagnose, deswegen erfolgt der Nachweis dieser Infektionskrankheit indirekt über einen Antikörpernachweis im Blut. Die Antikörper sind mit dem ELISA-Test sowie dem Western-Blot jahrelang im Blut nachweisbar und ein Indiz dafür, dass der Körper irgendwann einmal mit den Krankheitserregern in Kontakt gekommen ist. Etwa 50 % der Borreliose-Infektionen verlaufen jedoch ohne jegliche Symptome.
Im chronifizierten, latenten Stadium versagen ELISA und Western-Blot jedoch. Dann kann die Infektion nur mit dem Lymphozytentransformations-Test (Borellia-LTT) und dem Nachweis der CD57+NK-Zellen nachgewiesen werden. Diese NK-Zellen sind Killerzellen des Immunsystems, die sich spezifisch gegen die Borrelia-Bakterien richten.
Da sich die Borreliose mit vagen und unspezifischen Symptomen manifestiert, vermuten zunehmend mehr Menschen bei sich hinter scheinbar unerklärlichen Krankheitssymptomen wie Müdigkeit und Abgespanntheit, Schlafstörungen und unklaren Beschwerden eine Borreliose-Infektion.
Die ersten Symptome sind meist Kopfschmerzen, Wanderröte und Gelenkbeschwerden. Auch Muskelschmerzen, Nackensteifheit sowie Sehprobleme und Hörprobleme treten relativ häufig bereits im Frühstadium der Borreliose auf.
Grippeähnliche Symptome und Schlafstörungen können ebenfalls erste Anzeichen der Infektionskrankheit sein. Es können aber viele unspezifische Beschwerden hinzukommen. Und auch wenn die Wanderröte als sicheres Indiz für eine Borrelieninfektion gilt, so kommt sie doch nur bei etwa 50 Prozent der Betroffenen vor.
Therapie
Wer eine Zecke am eigenen Körper bemerkt, ist bei den oben genannten Symptomen bereits gewarnt und sollte so schnell wie möglich einen Arzt aufsuchen, damit die Krankheit nicht chronisch wird. Doch zahlreiche Patienten, bei denen die Borrelien-Antikörper nachgewiesen werden können, berichten, dass sie von keiner Zecke gebissen wurden. Dies hängt damit zusammen, dass nicht ausschließlich diese Parasiten als Überträger infrage kommen.
Auch können die Zecken theoretisch nach dem Blutsaugen wieder abgefallen sein, ohne von den Betroffenen bemerkt zu werden.
So erhalten viele vermeintliche Borreliose-Patienten immer wieder Antibiotika, um eine angebliche Infektion mit diesen Krankheitserregern zu bekämpfen, während die eigentliche Krankheitsursache im Dunkeln bleibt.
In meinem Beitrag: Schulmedizin bei Borreliose, gehe ich etwas näher auf das Therapieschema der „Schule“ ein.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter dazu an:
Vor allem, wenn Sie für den Erhalt der Homöopathie sind, sollten Sie sich unbedingt dazu eintragen, denn die „Politik“ und etablierte Medizinerschaft ist bestrebt, die Homöopathie zu verbieten und/oder abzuschaffen!
Die Therapie der Folgeerkrankungen
Unterscheiden muss man auch zwischen der akuten bakteriellen Infektion der Borreliose, die mit Antibiotika behandelt wird, solange sich die Bakterien noch im Körper befinden und unter den Folgeerscheinungen einer Borreliose-Infektion. Wenn die Patienten eine deutliche Wanderröte zeigen, ist eine Antibiotika-Therapie durchaus angezeigt.
Denn zu diesem Zeitpunkt liegt die Infektion noch nicht lange zurück. Die Medikation über einen Zeitraum von 50 Tagen hinweg ist nach Meinung von Spezialisten allerdings übertrieben. Eine Kurzeitbehandlung für 10 bis 14 Tage ist ebenso wirksam und kann Nebenwirkungen der Antibiotika minimieren helfen.
Die Bakterien können Folgeerkrankungen wie Arthrose an Gelenken oder Nachfolgeschäden an der Haut und Nerven hinterlassen. Diese Erkrankungen lassen sich nicht mit Antibiotika behandeln, da sich zu diesem Zeitpunkt keine Borreliose-Bakterien mehr im Körper befinden, die durch Antibiotika unschädlich gemacht werden könnten.
Entscheidend ist auch die Abklärung anderer möglicher Krankheitsbilder, die ähnliche Symptome, wie Gelenkbeschwerden und Nervenentzündungen verursachen wie beispielsweise Rheuma oder Multiple Sklerose.
Doch oftmals ist es ausgesprochen schwierig: Die Patienten leiden an chronischer Müdigkeit, an Fieber, Schwindel oder Depressionen. Oft werden sie eingehend und ohne befriedigendes Ergebnis untersucht.
Die chronischen Schäden durch die Infektion sind zum Teil auch Folgen der Entzündungs-Reaktionen. Vermieden werden können die Erkrankungen mit einer Behandlung, die auf einer Dämpfung, beziehungsweise Ausbalancierung, des Immunsystems beruht. In der Naturheilkunde kommt hier Cannabis zum Einsatz (siehe unten).
Antibiotika oft überflüssig
Denn nicht jeder Arzt kommt bei den Symptomen auf die Idee, auf Borreliose zu testen. Und selbst, wenn eine Antikörperbestimmung stattfindet, muss die Krankheit nicht zwingend erkannt werden. Denn die Tests liefern recht häufig falsche Ergebnisse.
Dabei sind auch falsch positive Resultate denkbar, etwa wenn ein Patient in der Vergangenheit infiziert war, aber längst nicht mehr akut erkrankt ist. Eine Behandlung könnte dann eine unnötige Medikation mit Antibiotika bedeuten.
Patienten mit falsch negativem Test hingegen blieben unbehandelt. Trotzdem sollte vorerst gelten, dass eine Antibiotika-Medikation nur bei positivem Ergebnis und bei gleichzeitig vorliegenden Symptomen erfolgen sollte.
Nur das Zeichen der Wanderröte, wenn sie sorgfältig beobachtet wurde, ist eine Indikation für die Behandlung auch ohne immunologische Untersuchung. Eine prophylaktische Gabe von Antibiotika an jeden Patienten mit Zeckenbefall ist strikt abzulehnen. Zu viele Menschen würden grundlos Medikamente einnehmen, die Nebenwirkungen zeitigen und Resistenz-Entwicklungen bei den Erregern fördern.
Das Borreliose-Paradoxon
Wir stehen hier vor dem sogenannten Borreliose-Paradoxon: Man muss erst die Krankheit behandeln, um sie identifizieren zu können. Denn die Krankheitserreger befallen unter anderem die weißen Blutkörperchen, um sie an der Entwicklung von Antikörpern zu hindern.
Zudem vermuten einige Forscher, dass Borrelien sich im Körper in einer ihnen typischen Form verstecken können. Dieser von den Bakterien gebildete Biofilm (pleomorphe Form) soll durch Antibiotika nicht angreifbar sein.
Bestimmte Stress-Faktoren sollen die Bildung des Biofilms auslösen. Dazu gehören Antibiotika-Kontakt, pH-Wert-Verschiebungen, immunologische Aktivität und Hunger. Bewiesen ist die Biofilm-Theorie jedoch nicht. Manche Wissenschaftler vermuten, dass die Erreger die pleomorphe Form nur in Labor-Kultur ausbilden.
Manche Ärzte schlugen vor, die Zecke, so sie denn verfügbar ist, auf die Erreger hin zu untersuchen. Dabei analysiert ein Labor vervielfachte DNA/RNA der in dem Spinnentier vorkommenden Mikroben.
Die mit dieser Polymerase-Kettenreaktion (PCR) hergestellten Mengen des Erregererbgutes können dann nachgewiesen werden. Der Test zeigt nicht nur, ob Borrelien, sondern auch FSME-Viren (Frühsommer-Meningoenzephalitis) und Rickettsien (Fleckfiebererreger) möglicherweise übertragen worden sind.
Aber das Vorhandensein der Erreger in der Zecke heißt ja noch lange nicht, dass der Patient auch infiziert wurde. Daher ist diese Untersuchung überflüssig, weil sie keine Sicherheit bietet.
Während der Borreliose-Bund Deutschlands von ca. einer Million chronischer Borreliose-Fälle in Deutschland ausgeht, relativieren die auf Borreliose spezialisierten Mediziner der Uniklinik Göttingen die tatsächliche Zahl der chronischen Borreliose-Erkrankungen auf ein Minimum.
Das klinische Krankheitsbild ist entscheidend
Entscheidend ist (nach deren Meinung): bei Vorliegen eines klinischen Krankheitsbildes (Symptome des Patienten), mittels einer gründlichen Untersuchung den Verdacht auf eine chronische Borreliose-Erkrankung zu bestätigen oder zu widerlegen und nicht für alle unklaren oder scheinbar unerklärlichen Krankheitssymptome das Krankheitsbild chronische Borreliose verantwortlich zu machen.
Ob es diese chronische Form der Erkrankung überhaupt gibt, ist mehr als zweifelhaft. Genauso unsinnig sind Dauer-Medikationen mit Antibiotika über viele Jahre hinweg. Testverfahren, die diese „Diagnose“ sichern sollen, sind völlig unzulänglich.
Da die Borreliose in verschiedenen Krankheitsstadien, abläuft erfordert diese auch eine differenzierte Herangehensweise. Während im Akutstadium (Stadium 1) die Antibiotika-Therapie der Schulmedizin wirksam ist, versagt diese in den Folgestadien.
Oft treten die Beschwerden, also die eigentliche Erkrankung, erst nach bis zu 8 Jahren nach der Infektion auf. Eine Antibiotika-Therapie ist dann sinnlos, weswegen der Arzt vor dem Problem steht, den Infektions-Zeitpunkt abzuschätzen.
Warum?
Bei der chronischen Borreliose scheinen die sogenannten zellwandfreien Formen der Borrelien (CWD, cell wall deficiency syndrom) eine Rolle zu spielen. Und genau diese Formen kann unser Immunsystem nicht ausreichend erkennen.
Nach meiner Erfahrung und der zahlreicher Kollegen lässt sich eine fortgeschrittene Borreliose ausschließlich über eine biologische Therapie heilen – und zwar vollständig.
Die phytomedizinische Therapie mit Beifuß (Artemisia) entdeckte Hildegard von Bingen. Der Erfolg dieser Behandlung ist heute durch wissenschaftliche Studien belegt. Die Forscher vermuten, dass die Wirkstoff-Kombination in dem Korbblütler so vielfältig ist, dass eine Resistenz-Entwicklung beim Erreger ausgeschlossen ist. In der Heilpflanze sind mehr als 600 Wirk-Substanzen enthalten.
Naturheilkunde, Alternative Medizin und Hausmittel
Dr. Dietrich Klinghardt behandelt Borreliose-Patienten recht erfolgreich mit einer speziellen Ozontherapie. Dr. Klinghardt geht davon aus, dass die Krankheitserreger durch elektromagnetischen Felder und Mikrowellen- bzw. Handystrahlungen in den vergangenen Jahren immer aggressiver wurden. Und wer das mit der Handystrahlung usw. für Unsinn hält, sollte einmal hier weiterlesen: Handystrahlung, WLAN und Co.
Dr. Klinghardt selber sagt auch, dass niemals ein Patient mit Alzheimer, Parkinson oder Multiple Sklerose bei ihm in Behandlung war, der nicht auch von Borrelien befallen war. Dies wiederum lässt vermuten, dass die genannten Erkrankungen, (deren Ursache bisher unklar ist), möglicherweise mit einer Infektion durch die Borrelien in Zusammenhang stehen könnte.
Und in der Tat gibt es auch Studien, die auf diesen Zusammenhang hinweisen! In meinem Beitrag: Multiple Sklerose und Borreliose – Werden hier Krankheiten verwechselt?, gehe ich genauer darauf ein.
Dr. Klinghardt empfiehlt seinen Patienten, Elektrosmog und Strahlungen von drahtlosen Geräten (WLAN, Bluetooth) möglichst zu vermeiden. Ausführlich lesen Sie dazu bei Dr. Klinghardt: „Die Lyme-Borreliose: Behandlungswege jenseits von Antibiotika„.
Einen umfangreichen Therapieplan, sowie weitere Gedanken zu einer alternativen Borreliose-Therapie stellt zum Beispiel mein Kollege Dieter Berweiler (aus Stuttgart) vor. Die Datei hat etwas mehr als 6 MB und ist auf seiner Webseite noch einsehbar (Stand Mai 2017). Dort finden Sie auch die Sache mit der Karde, die als wirkungsvoll gelten soll.
Zur Karde hier noch ein Bericht einer Kollegin:
„Die Kardenwurzelessenz wirkt sicher, die Behandlung muss aber über einige Monate durchgeführt werden, war letztendlich jedoch absolut erfolgreich durch eine auf den Patienten angepasste Therapie, d.h. genau dosiert und auf die Uhrzeiten abends nach zehn und morgens gegen sechs abgestimmt. Die Spirochäten sind nachtaktiv und verkrümeln sich tagsüber irgendwo. Da kann man sie nicht erreichen. Ernährung: rote Johannisbeere, Grüntee, Brennesseltee (zur Ausleitung der Giftstoffe), Löwenzahn, Holunder; Äußerlich: Luftbäder (6-10 Min.) Trockenbürsten, Bewegung (1-2 Stunden im Wald), warme Basenbäder (mind. 60 Min.), Dampfbäder“
Heilung durch Stevia-Extrakt?
Eine Studie aus 2015 legt eine Wirkung von Stevia-Extrakt gegen die Borrelien nahe. Die Forscher der University New Haven behandelten die Erreger in Kultur-Medien mit verschiedenen Präparaten des südamerikanischen Korbblütlers. Verwendet wurden wässrige Lösungen aus Trocken-Extrakten sowie alkoholische Auszüge.
Die Zubereitungen brachten die Wissenschaftler auf die Kulturen aus und verglichen die Wirkung mit Antibiotika-Behandlungen (Daptomycin, Doxycyclin, Cefoperazon in Einzelgabe und Kombinationen). Dabei zeigte sich, dass der alkoholische Auszug aus Stevia-Blättern eine bessere Wirkung hatte als die Antibiotika.
Sogar der Biofilm konnte mit dem Pflanzen-Extrakt so effektiv bekämpft werden, dass es nicht zum Wiederaufflammen der Bakterien-Rasen in den Petri-Schalen kam. Auch dies zeigt, dass der alkoholische Auszug aus Stevia die Erreger-Kulturen wirkungsvoller abtötet als die Antibiotika oder der Trocken-Extrakt (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4681354/).
Freilich lassen sich die Ergebnisse der Labor-Versuche zunächst nicht auf die klinische Praxis übertragen. Aber eine Rechtfertigung weiterer Forschungen sind sie allemal. Mehr dazu auch noch in meinem Beitrag: Stevia gegen Borreliose
Und was ich auch immer beachten würde: Die klassisch homöopathische Therapie der Borreliose!
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen Heilpflanzen-Newsletter dazu an. Darin geht es im Wesentlichen um Heilpflanzen, aber auch um Bachblüten oder Homöopathische Mittel:
Und wer jetzt denkt: „Stevia gegen Borrelien? Klingt ja schon fast zu gut…“ – dann wird’s noch interessanter.
Denn auch Forscher der Johns Hopkins University haben sich die hartnäckigen Persisterformen der Borrelien vorgenommen – also jene Überlebenskünstler, die sich in einem stoffwechselarmen Zustand verstecken und weder vom Immunsystem noch von Antibiotika zuverlässig erkannt oder bekämpft werden. In einer viel beachteten Studie (Feng et al. 2015) durchsuchten die Forscher eine komplette Datenbank mit bereits zugelassenen Medikamenten der US-Arzneimittelbehörde (FDA) – und fanden über 100 Substanzen, die gegen diese Borrelienformen wirksamer sind als jedes Standardantibiotikum. Da sind viele verschreibungspflichtige Medikamente dabei, aber auch einige „Natursubstanzen“…
Darunter:
- Methylenblau – ursprünglich ein Farbstoff, heute in der Mitochondrien- und Biofilmtherapie hochinteressant. Dazu mehr in meinem Beitrag: Wundermittel Methylenblau? Eine unterschätzte Substanz!
- Artemisinin – ein Pflanzenstoff aus dem Einjährigen Beifuß, bekannt aus der Malariatherapie
- Oltipraz – ein Antioxidans, das den zellulären Glutathionweg stärkt
- Fluconazol und Nystatin – eigentlich Antimykotika, mit überraschender Wirksamkeit gegen stationäre Borrelien
- sowie antivirale und antiparasitäre Mittel, die in klassischen Borreliose-Leitlinien keinerlei Erwähnung finden
Die Naturheilkunde denkt seit jeher systemisch: Biofilm, Mitochondrien, Ko-Infektionen, Mykosen, Entgiftungsstörungen – all das gehört bei einer chronischen Borreliose ins Blickfeld. Die moderne Forschung scheint genau diesen Weg zu bestätigen. Und auch wenn noch klinische Studien fehlen: Wer chronisch leidet, wird froh sein über jede plausible Option jenseits der Endlosschleife aus Antibiotika, Frust und Verlegenheitsdiagnosen.
Schauen wir uns den Beifuß genauer an!
Artemisia
Drei Arten der Gattung Artemisia (Beifuß) kommen in der Borreliose-Therapie infrage: der Gemeine Beifuß (Artemisia vulgaris), der Bittere Beifuß (Artemisia absinthium) und vor allem der Einjährige Beifuß (Artemisia annua), der durch seine Anwendung in der Malariatherapie international bekannt wurde. Was viele nicht wissen: Die moderne Forschung hat mittlerweile bestätigt, dass Artemisia-Wirkstoffe auch gegen Borrelia-Persisterformen hochaktiv sein können (wie ich oben bereits schrieb) – insbesondere in Kombination mit antioxidativen Substanzen wie NAC, Silymarin, Curcurmin.
Die Wirkung des Beifuß ist nicht monokausal: Es handelt sich eher um ein komplexes „Pflanzenarzneimittel“ mit über 600 Einzelsubstanzen – darunter Terpene, Flavonoide und polyzyklische Lactone, die synergistisch wirken.
Leider setzen viele Hersteller inzwischen auf isolierte oder sogar synthetisch hergestellte Artemisinin-Extrakte – ein fragwürdiger Trend. Nach meiner Erfahrung (und der vieler naturheilkundlicher Kollegen) ist es jedoch gerade die ganze Pflanze in naturbelassener Form, die die beste therapeutische Breite entfaltet. Pulverisierte Blätter und Blüten des Einjährigen Beifuß zeigen in der Praxis oft deutlich bessere Resultate als isolierte Wirkstoffpräparate. Entscheidend ist eine schonende Verarbeitung ohne aggressive Extraktion oder Hitze – so wie beim sogenannten Sansalva-Verfahren, das z. B. im Produkt Flamasan® zur Anwendung kommt.
Die traditionelle europäische Pflanzenheilkunde (etwa bei Hildegard von Bingen) empfahl Beifuß bereits zur prophylaktischen Anwendung in der warmen Jahreszeit. In heutiger Sprache würden wir sagen: zur Stabilisierung des Mikrobioms, zur Immunmodulation und zur schleichenden Regulation chronischer Entzündungsprozesse. Dass sich diese Sicht nun zunehmend mit modernen Forschungsergebnissen deckt, ist kein Zufall – sondern ein Beleg für das tiefgreifende Heilpotenzial dieser traditionsreichen Heilpflanze.
Cannabis
Die Cannabinoide der medizinischen Hanfpflanze sind geeignet, die dauernden und belastenden Entzündungs-Reaktionen herabzusetzen. Damit können die Spätfolgen einer chronifizierten Borreliose in Grenzen gehalten werden. Nachgewiesen ist hier die Wirkung von einigen der Pflanzenstoffe auf die CB2-Rezeptoren des Endocannabinoid-Systems. Während die Rezeptoren vom Typ CB1 im Nervensystem vorkommen, ist der Typ CB2 vor allem in den Membranen von Immunzellen vertreten.
Wegen ihrer regulierenden Wirkung auf das Immunsystem ist Cannabis daher auch in der Behandlung von Borreliose eine Alternative zu schulmedizinischen Medikationen. Beobachtet werden müssen allerdings Nebenwirkungen wie Appetitanregung, beschleunigter Puls sowie Austrocknung der Mundschleimhäute und orthostatische Probleme. Auch der relaxierende Effekt auf die Muskulatur kann bedenklich sein.
Die Multimodale Therapie
Die multimodale Therapie ist ein Konzept, das die Frage beantwortet, wie die latenten Erreger bekämpft werden können. Denn dadurch, dass sich die Mikroben in den Zellen verstecken, sind sie durch Antibiotika nicht erreichbar. Doch Borrelien sind stark hitzeempfindlich. Daher lassen sich die Keime durch eine Erhöhung der Körpertemperatur abtöten.
In der Vergangenheit hat es Versuche gegeben, Borreliose durch künstlich erzeugtes Fieber zu behandeln. Dabei wurde mit bewussten Infektionen durch Bakterien beim Patienten eine entzündliche Reaktion hervorgerufen, wozu auch Fieber gehört. Eine Alternative zu dieser Vorgehensweise ist die Ganzkörper-Hyperthermie im Rahmen der multimodalen Therapie.
Dabei wird der Patient im sogenannten Heckelbett mit Infrarot-A-Strahlen behandelt. Diese nebenwirkungsfreien Emissionen dringen in den Organismus ein, wodurch die Körpertemperatur auf bis zu 41,8 °C ansteigt. Die Behandlung dauert bis zu 3, in der Regel aber nur 1 bis 2 Stunden.
Da Antibiotika im fortgeschrittenem Stadium der Erkrankung ohnehin kaum nutzen, werden mit der multimodalen Therapie die Nebenwirkungen der keimtötenden Medikamente vermieden. Umgangen werden auf diese Weise Resistenz-Entwicklungen, Allergien und Schädigungen der Darmflora.
Einige Therapeuten entscheiden sich in Einzelfällen zu einer Doppel-Strategie. Sie wenden die Ganzkörper-Hyperthermie und Antibiotika gleichermaßen an. Dies geschieht in der Hoffnung, dass höhere Temperaturen die Entstehung resistenter Erreger unterbinden. Denn viele Resistenzen beruhen auf Membranproteinen in den Zellmembranen der Bakterien, die in der Lage sind, Antibiotika auszuschleusen. Diese Efflux-Pumpen funktionieren bei höheren Temperaturen nicht mehr oder nur suboptimal.
Prophylaxe/Vorbeugung
Die beste Vorbeugung gegen die Borreliose ist die Vermeidung von Zeckenbissen. Bei Aufenthalten in naturnahen Räumen empfehlen sich feste Schuhe und lange Hosen, die am Knöchel zusammengebunden sind.
Zu Hause sollten Sie dann den Körper auf Zeckenbefall kontrollieren. Hat eine Zecke zugestochen, sollte das Tier mit einer Pinzette ohne zu es zu quetschen und ohne Drehbewegung herausgezogen werden.
Die Spinnentiere mit allerhand Chemikalien abzutöten ist nicht sinnvoll, da der Stress dazu führen kann, dass verstärkt Speichel mit Borrelien in die Haut gelangt. Erst nach dem Entfernen ist ein Desinfizieren der Einstichstelle sinnvoll.
Ist die Impfung sinnvoll?
Besonders gefährdet sind Menschen aus Garten- und Forstberufen. Untersuchungen bei Jägern zeigten eine mit dem Lebensalter proportional ansteigende Infektions-Quote. Eine Impfung gegen Borrelia burgdorferi stand in den USA seit 1998 zur Verfügung.
Doch diese Spezies ist in Europa kaum verbreitet, weswegen hier keine Immunisierung möglich war. Das von GlaxoSmithKline entwickelte Präparat musste bereits 2002 wieder vom Markt genommen werden. Grund waren Autoimmunkrankheiten, die die Impfung nach sich zog. Bei vielen Patienten traten heftige Gelenkentzündungen auf. GlaxoSmithKline verlautbarte offiziell, dass die Einstellung der Produktion wirtschaftlich bedingt gewesen sei. Freilich konnte das Serum nach Bekanntgabe der Nebenwirkungen nicht mehr verkauft werden.
Baxter hat seit einigen Jahren ein Breitband-Serum gegen alle Borrelia-Arten in der Erprobung. Vorbehaltlich positiver Ergebnisse soll der Impfstoff bis 2020 auf den Markt kommen.
Ihre Meinungen und Erfahrungen mit dem Thema Borreliose interessieren nicht nur mich, sondern auch viele weitere Leser: Hinterlassen Sie doch bitte einen Kommentar hier im Blog zum Thema Borreliose. Klicken Sie einfach hier.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen Praxis-Newsletter mit den „5 Wundermitteln“ an:
Kleine Anmerkung: Die Sache mit den „5 Wundermitteln“ ist mit Abstand der beliebteste Newsletter, den meine Patienten gerne lesen…
Beitragsbild: 123rf.com – ralwel
Dieser Beitrag wurde letztmalig am 26.6.2025 aktualisiert.