
So geht Entspannung!
Einmal so richtig ausspannen und entspannen! Es gibt wohl niemanden, der diesen Seufzer nicht ab und zu mal von sich gibt. Doch könnten Sie die Frage, was eine gelungene Entspannung ausmacht, eindeutig beantworten? Finden Sie immer die Entspannung,…
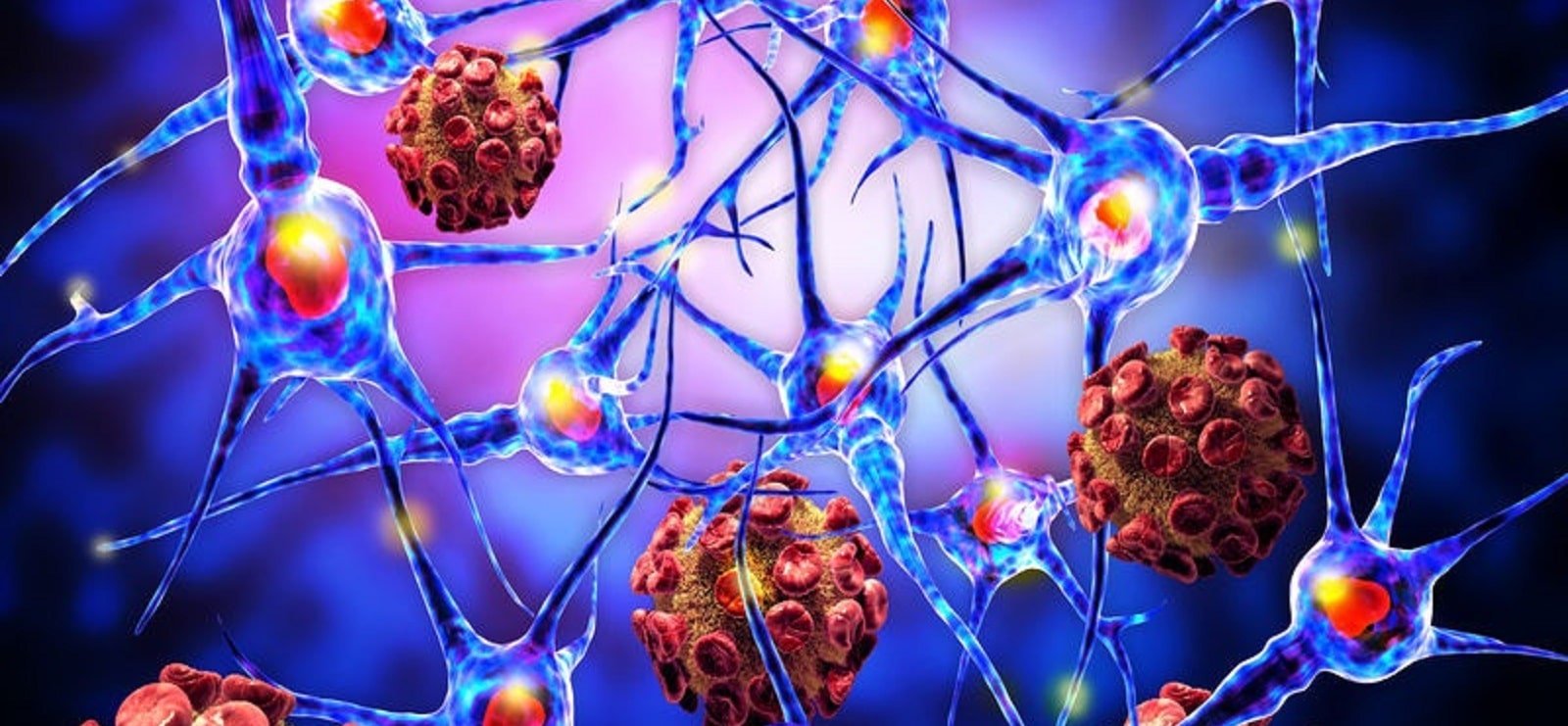
TENS – Transkutane elektrische Nervenstimulation
Die transkutane elektrische Nervenstimulation ist eine Behandlungsmethode, die inzwischen auf eine fast 50-jährige Geschichte zurückblicken kann.
Ihr Haupteinsatzgebiet sind (laut Wikipedia): „Chronische Schmerzsyndrome, die kausal nicht…

NPSO – Neue Punktuelle Schmerztherapie nach Siener
Heute können Diagnosen können durch immer mehr Forschungsergebnisse schneller und treffender gestellt werden und die Behandlung einzelner Symptome nimmt einen immer größeren Stellenwert ein.
Eine der neuen Methoden, um die Krankheitssymptome…
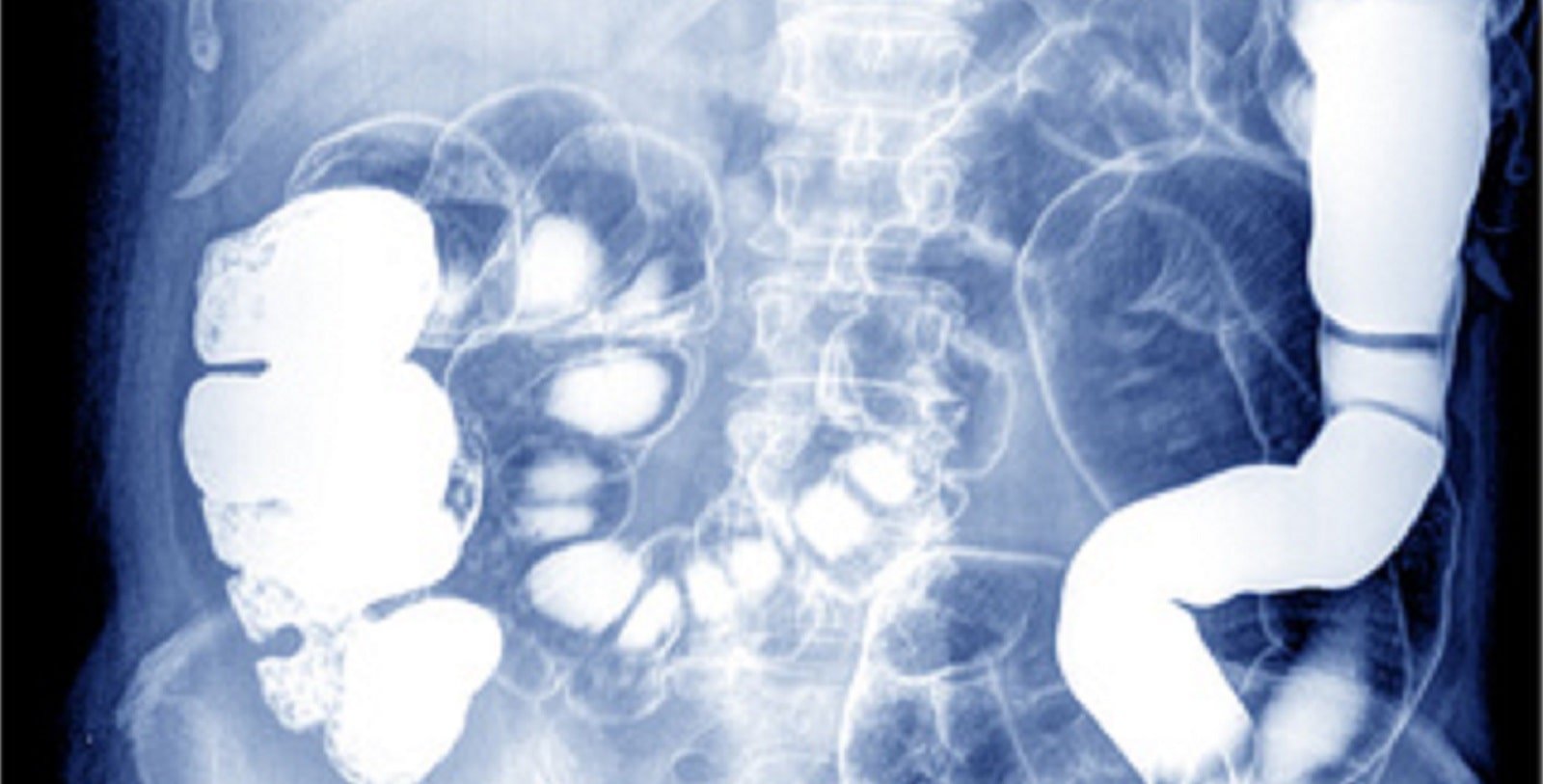
Neuraltherapie – eine Methode der alternativen Schmerzbehandlung
Bei der sogenannten Neuraltherapie handelt es sich um eine Methode zur Schmerzbehandlung aus dem Bereich der alternativen Medizin. Sie setzt dort an, wo die Schulmedizin oft schon aufgegeben hat.
Das Ziel der Neuraltherapie ist es, Störungen…




