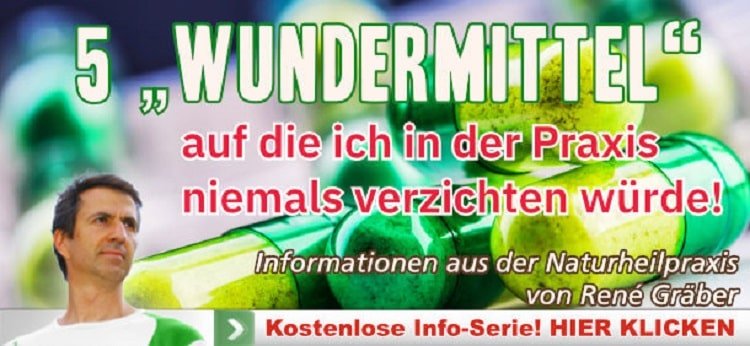Antibiotika bei jedem Ohrenschmerz? Operation bei jedem Paukenerguss? Die schulmedizinische Therapie der Mittelohrentzündung wirkt oft überstürzt – und greift zu tief in den Organismus ein. Dabei gibt es gerade in der Naturheilkunde eine Vielzahl wirksamer und bewährter Verfahren, die nicht nur Symptome lindern, sondern auch Rückfälle vermeiden können. Ob Homöopathie, Heilpflanzen, Schüßler-Salze, orthomolekulare Medizin, Cantharidenpflaster oder Hausmittel: Die Alternativmedizin bietet fundierte und praxisnahe Ansätze, um akute und chronische Mittelohrentzündungen sanft zu behandeln. In diesem Beitrag zeige ich, worauf es wirklich ankommt – und wann man besser nicht vorschnell zu Antibiotika greift.
Zu viele Antibiotika, zu viele Operationen?
Zu viele Antibiotika, zu viele Operationen: so könnte das Fazit der schulmedizinischen Therapie lauten. Die Alternativmedizin und die Naturheilkunde haben hier mehr als nur Alternativen zu bieten.
Die Mittelohrentzündung führt uns zunächst zum „Mittelohr“: Das Mittelohr ist ein luftgefüllter Raum, der durch das Trommelfell vom Gehörgang getrennt ist. Nach Ansicht der Schulmedizin können Erreger dennoch in diese Region vordringen und sich hier vermehren.
Das passiert dann, wenn die sich dort ansammelnde Flüssigkeit nicht mehr abfließen kann. Unter gesunden Verhältnissen geschieht dies durch die Eustachi-Röhre, die vom Mittelohr zur Mundhöhle führt. Der Ableitungsweg kann verstopft sein, wenn die Schleimhäute durch Schnupfen, Halsentzündungen oder allergische Reaktionen geschwollen sind. Der Verbindungsweg zwischen Ohr und Rachenraum kann auch durch Autoimmun-Erkrankungen oder anatomische Besonderheiten behindert sein. Bei Säuglingen und kleinen Kindern ist die Eustachi-Röhre immer etwas enger, weswegen die jüngsten Heranwachsenden zu den häufigsten Patienten mit Mittelohrentzündung gehören. In der Altersspanne zwischen 6 Monaten und 4 Jahren tritt die Erkrankung am häufigsten auf. 90 % aller Fälle kommen aus dieser Risiko-Gruppe.
Weitere Faktoren, die die Otits media fördern, sind Rauchen, Passivrauchen und eindringendes kontaminiertes Wasser beim Schwimmen. Daneben spielen auch Immunsuppressiva eine Rolle, die die Ausbreitung von Erregern fördern. Die häufigsten Erreger der Mittelohrentzündung sind Viren, nur bei Kindern unter 2 Jahren sind vor allem Staphylokokken, Pneumokokken, Streptokokken die Verursacher einer Otitis media.

Abb.1: Die sofortige (fast schon reflexartige) Verordnung von Antibiotika bei Mittelohrentzündungen im Kindesalter kann eigentlich nur als Fehler bezeichnet werden. Eine differenzierte Betrachtung ist dringend erforderlich! Bildquelle: Fotolia.com – Kitty
Und das bringt uns gleich zum Hauptproblem:
Gegen Viren helfen Antibiotika nicht, und so zeigten Studien, dass die Medikation nicht die Flüssigkeit im Mittelohr beseitigen kann. Das ist ebenfalls ein deutlicher Hinweis darauf, dass Bakterien nicht das Problem sein können. Ich kenne allerdings nur sehr sehr wenige Kinderärzte, die sich darüber Gedanken machen.
In der Tat zeigen sich Mittelohrentzündungen bei vielen Kinderkrankheiten und Allgemeinerkrankungen als Begleiterscheinung (unter anderem Schnupfen, Mandelentzündung, Scharlach, Masern). Im Alter von drei Jahren hatte fast jedes Kind bereits einmal eine Mittelohrentzündung. Die Schulmedizin geht dabei auf eine mögliche Verschleppung über den Blutweg aus. Daneben könne auch ein Defekt des Trommelfells (angeboren oder erworben) die Entzündung des Mittelohrs begünstigen.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen Heilpflanzen-Newsletter dazu an. Darin geht es im Wesentlichen um Heilpflanzen, aber auch um Bachblüten oder Homöopathische Mittel:
Symptome
Die Otitis media führt zu stechenden oder klopfenden Schmerzen im Ohr. Zusätzlich kann es zu Kreislaufproblemen (Schwindel), Fieberschüben, Schüttelfrost, in den Hals und die Schläfen ausstrahlenden Kopfschmerzen und einer verminderten Hörleistung kommen. Wenn noch Gleichgewichtsstörungen hinzukommen, ist höchstwahrscheinlich auch das Innenohr beteiligt. Daneben können Schwierigkeiten beim Atmen auftreten und Säuglinge und Kleinkinder sind leicht reizbar und unruhig.
Durch die klassischen Anzeichen einer Entzündung (Rötung, Erwärmung, Schwellung) sammelt sich Flüssigkeit (unter anderem Eiter) im Mittelohr, welches zu einer Drucksteigerung führt und das Trommelfell zersprengen kann (spontaner Abfluss der Flüssigkeit). Wenn das Trommelplatz reißt, tritt fast immer eine sofortige Besserung der Ohrschmerzen ein.
Die chronische Form ist weniger schmerzhaft, kann aber auf Dauer zu einer bleibenden Gehörschwäche (dumpfes Rauschen, hohe Töne werden kaum wahrgenommen) führen. Die Schwerhörigkeit ist besonders bei Kleinkindern problematisch, weil sie dann in der Sprachentwicklung zurückbleiben und irgendwann Stützunterricht brauchen. Wenn die Symptome über 14 Tage anhalten und mit einer andauernden Sekretion (Absonderung aus dem Ohr) verbunden sind, spricht das bereits für einen chronischen Verlauf. Die Folgeschäden können dann gravierend sein. Es kann sich eine Miningitis (Gehirnhautentzündung) entwickeln und ein destruktiver Erregerbefall des Wurzelfortsatzes. Dieser Knochenbereich hinder dem Ohr kann durchbrechen und so zur Einfallspforte für Bakterien in den Schädel werden. Die resultierende Sepsis kann tödlich enden.
Schulmedizinische Therapie
Zur Schmerzbehandlung verordnet der Schulmediziner in der Regel zunächst Ibuprofen oder Paracetamol. Ergänzend soll eine Rotlicht-Bestrahlung die Beschwerden lindern. In bestimmten Fällen wird das Trommelfell eröffnet (Parazentese), damit die entzündliche Flüssigkeit abfließen kann – in der Regel heilt das Trommelfell anschließend spontan wieder ab. Wird ein Belüftungsröhrchen eingesetzt (Myringotomie mit Paukenröhrchen), soll dies den Sekretabfluss längerfristig ermöglichen. Ob diese Maßnahme langfristig wirklich Vorteile bringt, ist jedoch umstritten – zumal das Risiko von Komplikationen wie Vernarbungen, Verkalkungen des Trommelfells oder Beeinträchtigungen des Gehörs besteht. Aus meiner Sicht stehen Nutzen und Risiko hier oft in keinem ausgewogenen Verhältnis.
Aus meiner Sicht wird auch hier viel zu schnell operiert – vor allem bei Kindern. Zwar kann ein anhaltender Paukenerguss langfristig das Hörvermögen beeinträchtigen, und ein chirurgischer Eingriff schafft kurzfristig Abhilfe. Doch ist das wirklich der einzige Weg? Die Schulmedizin hat hier erschreckend wenig Alternativen im Angebot.
Operative Maßnahmen sind in bestimmten Fällen durchaus notwendig – etwa wenn das Trommelfell bereits erheblich geschädigt ist oder wenn sich sogenannte Cholesteatome bilden. Dabei handelt es sich um gutartige, aber aggressive Gewebewucherungen, die das umliegende Gewebe zerstören können. In solchen Fällen wird das Trommelfell nach Ausheilung der Entzündung operativ rekonstruiert. Auch befallene Knochenanteile hinter dem Ohr müssen unter Umständen entfernt und durch eine Plastik ersetzt werden, um das Hörvermögen zu erhalten.
Oft heißt es, eine Mittelohrentzündung müsse wegen der Gefahr bleibender Hörschäden immer mit Antibiotika behandelt werden. Wer dem widerspricht – ob naturheilkundlicher Kollege oder besorgte Mutter – wird vom Hausarzt oder Kinderarzt nicht selten mit den üblichen Drohgebärden der „Drohmedizin“ zurechtgewiesen.
Ein Blick über die Landesgrenzen zeigt: Es geht auch anders. In Ländern wie den Niederlanden oder Schweden wird mit Antibiotika deutlich zurückhaltender umgegangen – und das bei vergleichbaren Behandlungserfolgen. Der internationale Vergleich offenbart: Was bei uns als medizinischer Standard gilt, ist anderswo oft bereits überholt.
In den USA und Australien zum Beispiel erhält fast jedes Kind ein Antibiotikum. In den Niederlanden nur fast jedes Dritte. Quelle: SIGN (Scottish Intercollegiate Guidelines Network). Diagnosis and management of childhood otitis media in primary care. A national clinical guideline. 2003.www.sign.ac.uk/guidelines/fulltext/66/index.html
Die Cochrane Collaboration kommt in einer Studienübersicht zu der Auffassung, dass unter Antibiotika die Schmerzen im Laufe des ersten Tages nicht beeinflusst werden. Dennoch geht es den meisten Kindern schon im Laufe des ersten Tages besser – sehr merkwürdig, oder? An den weiteren Tagen gingen die Schmerzen nur ein wenig zurück (unter Antibiotikagabe). Der Hörverlust wurde unter Antibiotikagabe gar nicht gebessert (dieser kann sogar für Wochen anhalten). Bei den meisten betroffenen Kinder ist es schwierig die wenigen Vorteile, die eine Antibiotikatherapie bietet, gegen die Risiken abzuwägen. Falls Sie Englisch lesen können, lohnt sich ein Blick in diese Studienübersicht: Antibiotics for middle-ear infection (acute otitis media) in children
Aber da ist nicht nur das Cochrane. Eine Studie aus 2016 belegt zwar eine Besserung der Beschwerden nach 7 Tagen bei 80 % der Patienten, wenn Antibiotika gegeben werden. Allerdings war das bei 70 % der Studien-Teilnehmer ohne die Medikamente auch der Fall: Treatment for acute middle ear infections. Das Arzneitelegramm fast die Analysen der aktuellen Studien in der Ausgabe 2/11 wie folgt zusammen:
Zwei aktuelle, auch in der Tagespresse („Lieber schlucken statt warten”) zitierte, randomisierte Studien aus den USA und Finnland zum Nutzen einer Antibiotikabehandlung bei kleinen Kindern unter zwei Jahren bzw. drei Jahren suggerieren einen größeren Nutzen als bislang gedacht und verleiten den Autor eines begleitenden Editorials zu geradezu euphorischer Bewertung. In beiden Studien wird eine sofortige antibiotische Behandlung mit abwartendem Vorgehen verglichen (angelegt als Plazebovergleich, jedoch Antibiotikabehandlung bei Verschlechterung).
Beurteilung durch das Arzneitelegramm:
Der Nutzen der sofortigen Antibiotikabehandlung erscheint höchstens moderat. Ein Blick auf die zahlreichen Protokollveränderungen im Verlauf und nach Abschluss der Studie weckt jedoch ernste Zweifel an der Integrität der Daten. […] Wir halten aufgrund der schweren methodischen Defizite die Arbeit für wenig glaubwürdig.
Die medizinischen Studien „kranken“ in einem erschreckenden Ausmaß an Glaubwürdigkeit. Ausführlich schreibe ich dazu in meinem Report: Unsere Schulmedizin – Die einzig wahre Wissenschaft?
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter dazu an:
Weiter im Arzneitelegramm:
Würden alle Kinder sofort antibiotisch behandelt, erkauft man das etwas raschere Abklingen der akuten Symptome mit Störwirkungen und einer problematischen Resistenzlage. Möglicherweise wird zudem durch übermäßigen Antibiotikagebrauch der Langzeitverlauf ungünstig beeinflusst: Daten aus einer Nachbeobachtungsstudie mit 168 Kindern zwischen sechs Monaten und zwei Jahren, die im Rahmen einer randomisierten Studie Antibiotika oder Plazebo erhielten, lassen eine höhere Rezidivrate innerhalb von 3,5 Jahren in der Antibiotikagruppe im Vergleich zu Plazebo erkennen (63% vs. 43%).
http://www.arznei-telegramm.de/html/2011_02/1102017_01.html
Interessant die Aussage, die Naturheilkundler schon seit Jahrzehnten machen: Ständig mit Antibiotika behandelte Kinder haben öfter mit einer Mittelohrentzündung zu tun. Quelle: http://www.bmj.com/content/338/bmj.b2525.full
Genau das ist ein Phänomen, das ich aus der Praxis nur bestätigen kann.
Dabei sind das gar keine neuartigen Erkenntnisse. Denn bereits 1991 titelte eine Ärztezeitschrift (das MIMS Magazin in den USA) bereits mit der Überschrift: Otitis Media: Können Sie aufhören Rezepte nur wegen der Mutter zu verschreiben?
Ein weiteres Problem ist, dass viele Ärzte Antibiotika verordnen, BEVOR sie WISSEN, dass es wirklich notwendig ist. Denn wie ich oben bereits anführte: es ist gar nicht erwiesen, dass die Bakterien die Ursache sind.
Ich kann die Vermutung des Arzneimitteltelegramms nur bestätigen, dass die Kinder die mehrmals wegen einer Mittelohrentzündung mit Antibiotika behandelt werden in deren Immunlage weiter geschwächt werden.
Soweit muss es aber nicht kommen…
Naturheilkunde, Alternativmedizin & Hausmittel
Im Folgenden versuche ich einige naturheilkundliche und Alternative Therapieverfahren zu beschreiben, die bei einer Mittelohrentzündung in Frage kommen können.
Hinweis vorab: Das richtige Schnäuzen ist wichtig. Niemals beide Nasenlöcher zuhalten, weil dabei die Erreger im Nasensekret in die Ohren gelangen könnten. Also immer ein Nasenloch nach dem anderen schnäuzen. Mit einem Kind üben Sie das mittels einer „Partytröte“, in die das Kind versucht mittels Nase zu pusten. Das übt man natürlich NICHT bei einem akuten Fall.
Cantharidenpflaster
Ein altbewährtes Mittel, bei hartnäckigen oder rezidivierenden Mittelohrentzündungen ist das Cantharidenpflaster. Heute fast vergessen, aber in erfahrenen Händen eine ausgesprochen wirkungsvolle Option. Es wird hinter dem Ohr auf Höhe des Mastoids aufgeklebt (Briefmarkengröße reicht), reizt gezielt die Haut und fördert über diesen Umweg eine intensive Durchblutung sowie eine reflektorische Ableitung der Entzündung aus dem Ohrbereich.
Der Effekt ist vergleichbar mit einem künstlich gesetzten kleinen Hautreiz, der das Immunsystem vor Ort anregt und den Druck im Mittelohr entlasten kann. Wichtig ist, das Pflaster nicht länger als 12 bis 24 Stunden einwirken zu lassen, da es eine Blase erzeugt – gewollt, aber kontrolliert. Danach folgt eine mehrtägige Pause. Bei Kindern setzen wir dieses Verfahren nicht ein – ihre Haut reagiert deutlich empfindlicher, und die Reiztherapie wäre hier zu stark. Doch bei Erwachsenen mit chronisch wiederkehrenden Beschwerden, bei denen Antibiotika langfristig keine Lösung bieten, hat sich das Cantharidenpflaster durchaus bewährt.
Chiropraktik
Ein oft übersehener Aspekt bei wiederkehrenden Mittelohrentzündungen ist die Statik der oberen Halswirbelsäule. Besonders das erste und zweite Halswirbelgelenk (Atlas und Axis) sowie Blockaden im Bereich der oberen Kopfgelenke können die Durchblutung und Lymphdrainage im Ohr-Nasen-Rachen-Raum beeinträchtigen. Auch das vegetative Nervensystem, das über die Wirbelsäule mit dem Mittelohr verbunden ist, kann in seiner Regulation gestört sein.
Sanfte chiropraktische oder osteopathische Justierungen – insbesondere im Bereich der oberen Halswirbel – können Spannungen lösen, die Belüftung über die Eustachische Röhre verbessern und so die Rückbildung chronischer Ergüsse oder Entzündungen fördern. Wichtig ist: Bei Kindern sollte die Behandlung nur durch erfahrene Therapeuten erfolgen, die auf pädiatrische Chiropraktik oder osteopathische Techniken spezialisiert sind.
Besonders sinnvoll ist die chiropraktische Behandlung bei chronischen Mittelohrentzündungen, die mit:
- häufigem Schnupfen oder vergrößerten Rachenmandeln,
- kieferorthopädischen Fehlstellungen oder
- wiederholtem Sekretstau im Mittelohr
einhergehen. In solchen Fällen lohnt sich die Zusammenarbeit mit einem naturheilkundlich arbeitenden Chiropraktiker oder Manualtherapeuten.
Ernährung
Viel trinken, um Stoffwechselprodukte der Entzündung auszuschwemmen und den Wasserverlust durch das Fieber auszugleichen. Keine Milch (mehr dazu auch unter „Milch trinken„, kein Schweinefleisch, keine Süßigkeiten, keine verarbeiteten Lebensmittel, kein weißes Mehl, kein Gluten, keine Erdnüsse und Garnelen (Allergene) während der Entzündung. Ich rate dazu, diese „Nahrung“ für immer weg zu lassen.
Vorbeugend gegen Entzündungen wirkt der Verzehr von reichlich Obst und Gemüse. Mehr verzehrt werden sollten Knoblauch, Ingwer, Kurkuma, Gewürze und Kräuter.
Heilpflanzen
Andorn (Marrubium vulgare): Wirkt schleimlösend und fördert die Belüftung über die Eustachische Röhre. Dosierung: z. B. als Tee (1 TL Kraut auf 150 ml, 2–3× täglich) oder als Bestandteil pflanzlicher Kombinationspräparate. Dauer: 7–10 Tage in der akuten Phase.
Schlüsselblume, Enzian, Holunder, Eisenkraut (als Phytokomplex): Diese Kombination unterstützt den Sekretabfluss, wirkt entzündungshemmend und stärkt die Schleimhäute.
Dosierung: z. B. als Tropfenpräparat (z. B. Sinupret®), 3× täglich 50 Tropfen. Dauer: 10–14 Tage.
Kapland-Pelargonie (Pelargonium sidoides): Aktiviert die Immunabwehr und wirkt antiviral sowie antibakteriell. Dosierung: z. B. 3× täglich 30 Tropfen (Umckaloabo®). Dauer: 7 Tage, bei Bedarf bis 14 Tage.
Myrte (Myrtus communis): Entzündungshemmend und schleimlösend, ideal zur Inhalation bei begleitender Nasennebenhöhlenbeteiligung. Dosierung: 2–3 Tropfen ätherisches Öl in heißem Wasser inhalieren, 1–2× täglich. Dauer: 5–7 Tage.
Echinacea (Echinacea purpurea): Immunstärkend, besonders geeignet zur Nachbehandlung und Rückfallprophylaxe. Dosierung: 3× täglich 20–30 Tropfen oder 2× täglich 300 mg Extrakt.
Dauer: 2–3 Wochen nach Abklingen der akuten Beschwerden.
Diese Pflanzen lassen sich in der Praxis gut kombinieren – entweder als Fertigpräparat oder individuell auf den Patienten abgestimmt.
Homöopathie
Im akuten Fall muss das Mittel „sitzen“. Das „Herumprobieren“ der Eltern hilft meist nichts. Mittel die in Frage kommen: Aconitum, Belladonna, Dulcamara, Ferrum Phosphoricum, Hepar Sulfuris, Mercurius solubilis, Pulsatilla, Silicea
Orthomolekular-Medizin
In der orthomolekularen Medizin hat sich bei Mittelohrentzündungen vor allem die gezielte Gabe entzündungsmodulierender Mikronährstoffe bewährt. Im Mittelpunkt stehen hier Vitamin C (z. B. 2–3 g täglich in geteilten Dosen) und Zink (z. B. 20–30 mg täglich), da beide das Immunsystem stärken und die Schleimhäute regenerieren helfen.
Zusätzlich kann Vitamin A (in moderater Dosierung, etwa 5.000–10.000 I.E. täglich) die Schleimhautbarriere im Nasen-Rachen-Raum stabilisieren – ein wichtiger Schutzmechanismus gegen aufsteigende Infektionen Richtung Mittelohr. Bei chronischen Verläufen oder häufigen Infekten hat sich auch die Kombination aus Selen (z. B. 100–200 µg täglich) und Quercetin als entzündungshemmende Maßnahme bewährt.
Gerade bei Erwachsenen, die immer wieder mit Paukenergüssen oder belüftungsbedingten Mittelohrproblemen zu tun haben, kann eine individuell abgestimmte Mikronährstofftherapie den entscheidenden Unterschied machen.
Auch der Vitamin-D-Spiegel spielt bei Mittelohrentzündungen eine zentrale Rolle, wird aber oft übersehen. Ein gut eingestellter Vitamin-D-Wert stärkt nicht nur die allgemeine Immunabwehr, sondern wirkt auch gezielt regulierend auf entzündliche Prozesse im Bereich der oberen Atemwege und Schleimhäute. In der Praxis zeigen sich immer wieder auffällig niedrige Spiegel bei Patienten mit chronisch-rezidivierenden Mittelohrentzündungen. Zielwert sollten mindestens 40–60 ng/ml (25-OH-Vitamin D) sein. Zur Auffüllung eignen sich, je nach Ausgangswert, Dosierungen zwischen 2.000 und 5.000 I.E. täglich – idealerweise in Kombination mit Vitamin K2. Wer häufiger an Ohrinfekten leidet, sollte den Vitamin-D-Spiegel regelmäßig kontrollieren und gezielt auffüllen: Es ist ein kleiner Aufwand mit oft großer Wirkung.
Isopathie
Notakehl D5 mehrmals täglich einige Tropfen einnehmen, einen Tropfen in das Ohr träufeln und im Bereich der Lymphknoten am Kopf verreiben.
Säure-Basen-Haushalt
Ein oft übersehener Aspekt bei wiederkehrenden Mittelohrentzündungen im Erwachsenenalter ist der gestörte Säure-Basen-Haushalt. Chronische Übersäuerung kann das Milieu im Nasen-Rachen-Raum negativ beeinflussen, Schleimhäute reizen und entzündliche Prozesse begünstigen. Gerade bei Erwachsenen mit einem stark säurelastigen Lebensstil – viel Kaffee, Zucker, tierisches Eiweiß, wenig Gemüse – lohnt es sich, hier gezielt gegenzusteuern. Basenpulver (z. B. mit Citraten von Magnesium, Kalium und Calcium) haben sich bewährt, ebenso eine bewusst basenreiche Ernährung.
Dosierung: 1–2× täglich ein Teelöffel Basenpulver in warmem Wasser, am besten nüchtern oder vor dem Schlafengehen. Dauer: meist 2–3 Wochen, bei Bedarf auch länger.
Bei Kindern hingegen spielt der Säure-Basen-Haushalt in der Regel keine klinisch relevante Rolle – ihr Stoffwechsel kompensiert kurzfristige Ungleichgewichte meist problemlos. Wichtig bei Kindern ist die Ernährung; vor allem Zucker, Süßigkeiten, Schweinefleisch und Milchprodukte müssen gemieden werden.
Schüssler-Salze
Im ersten akuten Stadium: Ferrum Phosphoricum
Nach Abklingen der akuten Entzündung: Kalium Chloratum
Zur Ausheilung: Silicea
Bei gerissenem Trommelfell zur Ausheilung: Calcium Sulfuricum
Zahnstörfeld
Vor allem bei Erwachsenen, die immer wieder mit Mittelohrentzündungen zu tun haben und bei denen andere Maßnahmen bisher nur unzureichend wirkten (wie ich diese hier zum Beispiel beschreibe), rate ich generell „Probleme der Zähne“ in Betracht zu ziehen. Wurzelbehandelte Zähne stören grundsätzlich den ganzen Organismus. Auch Amalgam-Füllungen können bedenklich sein. Sie sollten sie durch einen in diesen Sachen erfahrenen Zahnarzt sanieren lassen.
Sonstiges
Eine Studie der Universität Seoul bestätigte ein sehr interessantes Hausmittel: Essig. Mindestens vier mal täglich ein Tropfen Essig in das betroffene Ohr. Hierzu brauchen Sie eine Pipette (Apotheke). Essig: nur natürlich vergorener Weinessig oder Apfelessig.
Fencheldampfbäder über den Ohren und das Auflegen von Kohlblättern sind bewährte Hausmittel.
Wechsel-Fußbäder: Abwechselnd in warmes und kaltes Wasser stellen, bis die Füße entweder warm oder kalt sind. Diese Prozedur 10 mal wiederholen. Zum Abschluss eine kalte Anwendung – aber Achtung: Die Füße müssen zum Schluss warm sein! Während der Anwendung darf man NICHT frieren. Also warm halten.
Ein Zwiebelwickel hinter den Ohren verhilft zur Ableitung.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen Praxis-Newsletter mit den „5 Wundermitteln“ an:
Kleine Anmerkung: Die Sache mit den „5 Wundermitteln“ ist mit Abstand der beliebteste Newsletter, den meine Patienten gerne lesen…
Beitragsbild: 123rf.com – iakovenko
Dieser Beitrag wurde letztmalig am 6.5.2025 überarbeitet und ergänzt.